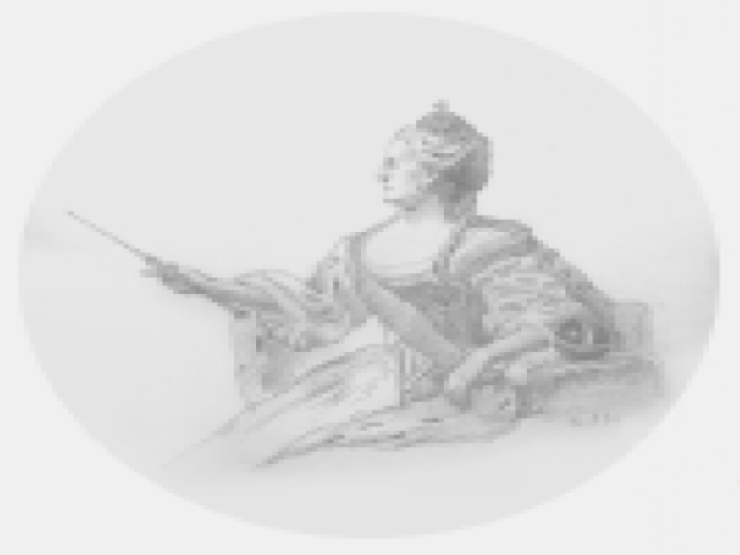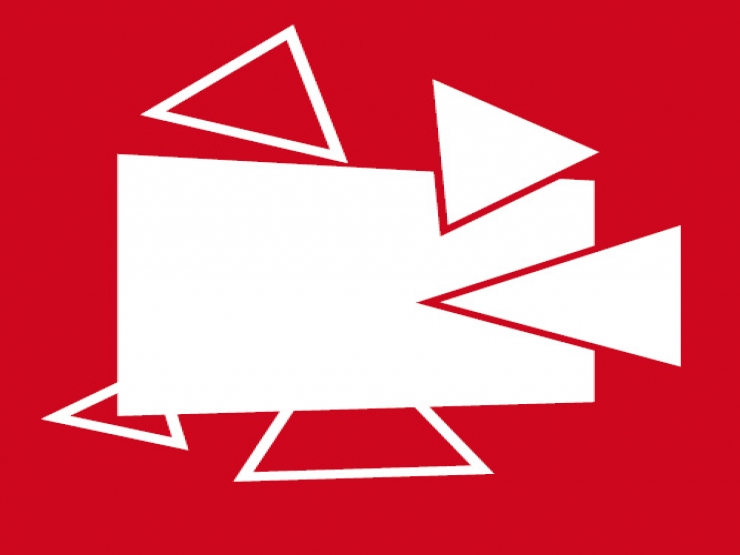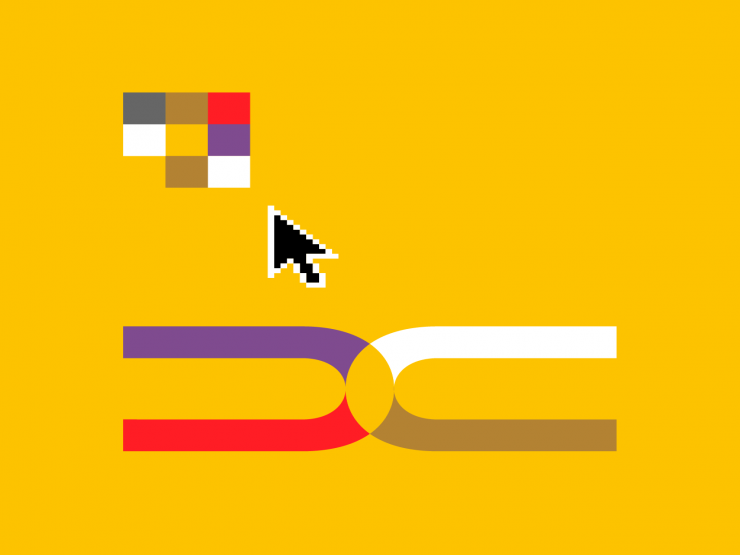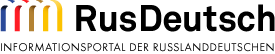Von Moskau über Friedland nach Schweinfurt: Eine etwas andere Reiseerzählung
Noch ist nicht der letzte Antrag ausgefüllt, nicht der letzte Zuschuss bewilligt. Aber Jekaterina Lik hat mit fast 60 Jahren die meisten Hürden einer russlanddeutschen Spätaussiedlerin überwunden. Für die MDZ schildert sie den Weg, der dafür zurückzulegen war und auch an einem Ententeich vorbeiführte.
Die Vorgeschichte
Meine Familie stammt aus der Ukraine, aber die große Politik wollte es so, dass ich 1956 in Kasachstan zur Welt gekommen bin. Als Deutsche wurde meine Mutter mit ihren Eltern 1936 von der Ukraine nach Kasachstan zwangsumgesiedelt. (Anm. d. Red.: Mitte der 30er Jahre ließ Stalin die Grenzregionen der Sowjetunion „säubern“. Mehrere hunderttausend Angehörige von „unzuverlässigen“ Minderheiten – Finnen, Polen, Deutsche, Koreaner – fanden sich hauptsächlich in dünn besiedelten Gegenden Zentralasiens wieder.) Russland hat meine Mutter in den 90er Jahren als Opfer von politischer Verfolgung anerkannt und ihr außerdem bescheinigt, dass in ihrem Pass als Nationalität nie etwas anderes als „deutsch“ eingetragen war. Die amtlichen Papiere hüte ich wie meinen Augapfel: Sie bezeugen unsere Familiengeschichte und meine deutsche Abstammung.
Der Aufnahmebescheid
Im April dieses Jahres wird meinem Antrag auf Übersiedlung nach Deutschland stattgegeben – ein Erfolg im zweiten Anlauf. 2005 war ich noch daran gescheitert, in meinem ersten Sowjetpass als Nationalität ukrainisch genannt zu haben, nicht deutsch. Ich hatte mit damals 16 Jahren auf meine Oma gehört: Sie wollte, dass mir ein ähnliches Schicksal wie ihnen erspart bleibt.
Weil an diesen Umständen nun aber nichts mehr zu ändern war, habe ich mich mehr oder weniger damit abgefunden, keine neue Chance zu bekommen. Doch dann hat Deutschland 2013 sein Aufnahmegesetz geändert. (Anm. d. Red.: Das Bundesvertriebenengesetz schreibt seitdem kein „durchgängiges Bekenntnis zum deutschen Volkstum“ mehr vor.) Damit stehen mir die Türen zu jenem Land offen, in dem bereits ein Großteil meiner Verwandtschaft lebt.
Die Beweggründe
Viele raten mir von der Ausreise nach Deutschland ab und verweisen darauf, dass nicht jeder Spätaussiedler dort glücklich wird, manche sogar zurückkehren. Aber alle, die ich kenne oder mit denen ich gesprochen habe, sind zufrieden. Mein ehemaliger Chef in Kasachstan, bereits seit 1993 in Deutschland, hat mir einmal gesagt: „Katja, hier sind die Menschen sozial abgesichert.“ Das sieht man besonders an den Rentnern. In Deutschland können die es sich sogar leisten, Urlaubsreisen zu unternehmen. In Russland sind Rentner dagegen die ärmste Schicht der Bevölkerung. Wenn sie nicht arbeiten, solange die Füße sie noch tragen, reicht das Geld nur für Brot und Milch. Meine beiden Töchter unterstützen mich übrigens in meinem Wunsch. Jetzt haben sie bald einen Grund mehr, Deutschland auch selbst zu besuchen. Und meine Enkel kommen vielleicht später zum Studieren und Arbeiten.
Die Herausforderung
Im Unterschied zu meiner Verwandtschaft fahre ich allein nach Deutschland. Aber das schreckt mich genauso wenig wie die Perspektive, dass mich vor Ort niemand in Empfang nehmen kann, weil meine Cousinen doch arbeiten müssen. Ich lebe schon seit 1989 allein, seit der Scheidung von meinem Mann. Seit 15 Jahren bin ich in Russland und habe die unterschiedlichsten Arbeiten gemeistert, von der Leitung eines russlanddeutschen Kulturzentrums in Kineschma an der Wolga bis zur Kinderbetreuung in einem Heim der Salesianer Don Boscos in Moskau. Mein Häuschen in Kasachstan musste ich für 200 Dollar verkaufen, seitdem teile ich mir Mietwohnungen mit anderen Leuten, was nicht immer einfach ist. Mehr lässt mein Gehalt nicht zu. Aber ich bin dankbar für diese Lebensschule. Jetzt möchte ich die Planke wieder höher legen, wie die Latte beim Stabhochsprung.
Das Gepäck
Das Meiste des Wenigen, was mir gehört, verschenke ich in Moskau an Freunde. Ein Teil geht mit nach Kaliningrad, wo eine meiner Töchter lebt und von wo aus Kleinbusse nach Deutschland fahren. Mein Gepäck besteht aus zwei Koffern, einem Beutel und einem Rucksack. Darin sind Ober- und Unterbekleidung, Schuhe, ein Blutdruckmesser, Arznei für alle Fälle, einige Ikonen, ein Gebetbuch, zwei Wörterbücher, Kosmetik, etwas Geschirr und Lebensmittel. Dazu Notebook, Fotoapparat und Handy, um mit allen in Verbindung zu bleiben.
Die Ankunft
Als der Busfahrer mein Reiseziel – das Grenzdurchgangslager Friedland – erfährt, fragt er, ob ich keine Angst hätte. Ihm sei selbst bange, „wegen der Flüchtlinge und der vielen Polizei“. Aber als wir nach 14 Stunden Fahrt in Friedland eintreffen, am 5. Oktober um 1.30 Uhr, sind weder Flüchtlinge noch Polizisten zu sehen, und auch die Pforte neben der Schranke ist unbesetzt. Ich laufe durch die Dunkelheit auf ein Zimmer zu, wo noch Licht brennt, und klopfe. Mir öffnet ein Syrer, er bringt mich zum Diensthabenden. So lande ich schließlich auf meinem Zimmer 14 im Heim 5, dessen drei andere Bewohner kurz vor mir eingetroffen sind und noch nicht schlafen. Meine Zimmernachbarn für die nächsten fünf Tage: Eleonora aus Karaganda in Kasachstan sowie Lena und ihre 16-jährige Tochter Kristina aus der russischen Schwarzmeerstadt Anapa.
Das Lagerleben
Bei meinem ersten Bürotermin um 8 Uhr morgens werden mir ein Zimmerschlüssel und Essensmarken für die Kantine ausgehändigt, die ich dann aber gar nicht in Anspruch nehme, weil ich mich noch mit den mitgebrachten Lebensmitteln verpflegen kann. Die Verständigung ist holprig, und der Ton wird vorwurfsvoll: „Wer nach Deutschland kommt, sollte Deutsch können“, heißt es.
Neuankömmlinge erhalten ein Informationsblatt, dem der weitere Ablauf zu entnehmen ist und das auch als Lageplan des Lagers dient. Darauf sind 54 Wohnheime verzeichnet: einstöckige Gebäude zu je 14-16 Vierbettzimmern. Nur zwei Heime sind von Spätaussiedlern belegt, die übrigen von Flüchtlingen. Weil der Platz nicht für alle von ihnen reicht, werden sogar Matratzen in den Korridoren der Bürogebäude ausgelegt. Für die Kinder stehen Fahrräder und Roller bereit, die Älteren spielen Ball. Soweit ich das beurteilen kann, läuft alles in geregelten Bahnen. Das Rote Kreuz händigt uns Lagerinsassen Geschenke aus. Für mich gibt es einen Bademantel, Turnschuhe, Stretchhosen und ein Wörterbuch.
Die Sprachbarriere
Wenn man es als Spätaussiedler bis nach Friedland geschafft hat, dann wird man nicht wieder zurückgeschickt. Es sei denn, man benimmt sich unmöglich. Einigen jungen Männern aus Kasachstan soll das gelungen sein, erzählt man sich. Sie hätten Enten aus dem Lagerteich eingefangen und gebraten. Daraufhin seien sie abgeschoben worden.
Ich bin bei den Terminen mit den Sachbearbeitern nervös, aber nicht deshalb, weil das böse Konsequenzen haben kann. Leider ist mein Deutsch nicht so gut, wie ich es gern hätte. Ich war aber schon in der Schule immer unter den Besten, ich möchte alles richtig machen und ärgere mich, wenn man sich über mich ärgert. Einer der Beamten muntert mich auf, als ich das Gespräch mit ihm überstanden habe: „Na, das war doch gar nicht so schlimm, oder?“
Die Ortsfrage
In einem der Anträge sollen wir angeben, wo in Deutschland wir künftig wohnen wollen. Ich schreibe Landshut, dort ist eine meiner Cousinen zu Hause. Aber mir wird letztlich ein anderer Wohnort zugeteilt, nämlich Schweinfurt. Dasselbe erleben auch andere, die mit mir im Lager sind. Die Wünsche werden sozusagen zur Hälfte berücksichtigt: das Bundesland ja, die Stadt nein. Für mich geht es also nach Bayern.
Die Formalitäten
In Schweinfurt beziehe ich ein Wohnheimzimmer im Zentrum. Die Wohnheimleiterin Frau Bauer und die Übersetzerin Frau Kiel kommen beide aus Sibirien, leben aber schon 20 Jahre in Deutschland und arbeiten mit Spätaussiedlern. Eine große Hilfe für mich sind aber auch meine Nachbarn, die mir zeigen, wo sich die wichtigsten Anlaufstellen in der Stadt befinden: das Rathaus, das Jobcenter, die Sparkasse, die AOK. Die Kopie des Eintrags beim Einwohnermel- deamt muss ich nach Friedland schicken, um von dort den Nachweis zu erhalten, dass ich Spätaussiedlerin bin. Damit kann ich den deutschen Ausweis und Reisepass beantragen.
Ich brauche eine Krankenversicherung und ein Konto. Im Jobcenter wird meine Beihilfe festgelegt. Soviel ich weiß, sind das 399 Euro im Monat, aber das erfahre ich noch genau. Man teilt mir mit, dass ich ohne Erlaubnis meines Beraters an Arbeitstagen nicht die Stadt verlassen darf. Für den Fall, dass deshalb Termine platzen, sind Beihilfekürzungen von 30 Prozent, im Wiederholungsfalle bis zu 100 Prozent angedroht.
Bis ich mich eingelebt habe, möchte ich im Wohnheim bleiben. Mir steht aber auch eine eigene Wohnung zu, mit bis zu 50 Quadratmetern. Die Warmmiete von bis zu 420 Euro trägt der Staat, solange ich kein eigenes Einkommen habe oder Rente beziehe, dazu Herd, Waschmaschine und einen Zuschuss für die Möbel. In Russland, wo das Renteneintrittsalter für Frauen bei 55 Jahren liegt, beträgt meine Rente derzeit 10 039 Rubel, umgerechnet etwa 140 Euro. Wie das in Deutschland wird, kann ich noch nicht sagen. Ich möchte auf alle Fälle weiterhin arbeiten.
Die Deutschen
Schweinfurt ist eine schöne Stadt mit viel Grün und höflichen Menschen, die einander mit Respekt begegnen und von denen man ständig gegrüßt wird. Ich habe noch niemanden fluchen hören, wie das in Russland am laufenden Band passiert. Die Leute ziehen sich unauffällig an, ihre Kleidung ist bequem und praktisch und vorwiegend in Pastelltönen gehalten. Bald werde ich mich mit ihnen auch besser unterhalten können. Ende November beginnt mein Sprachkurs: Von da an werde ich sieben Monate lang drei Stunden Deutsch am Tag lernen.
Übersetzt von Tino Künzel
Moskauer Deutsche Zeitung