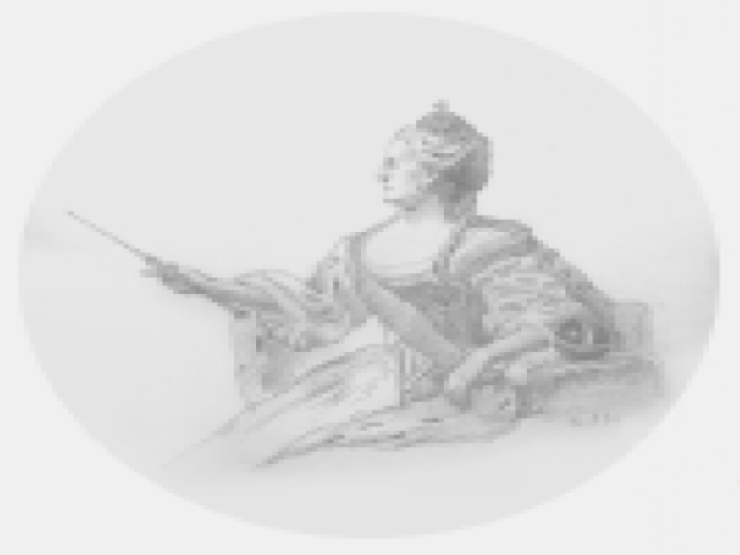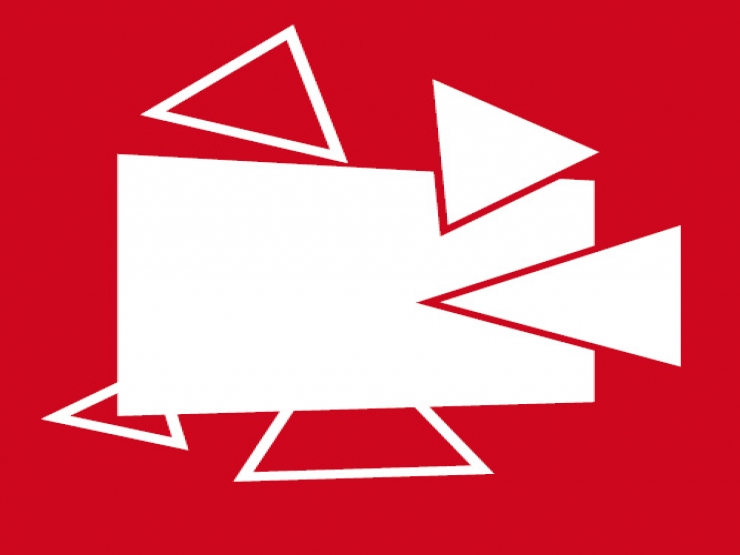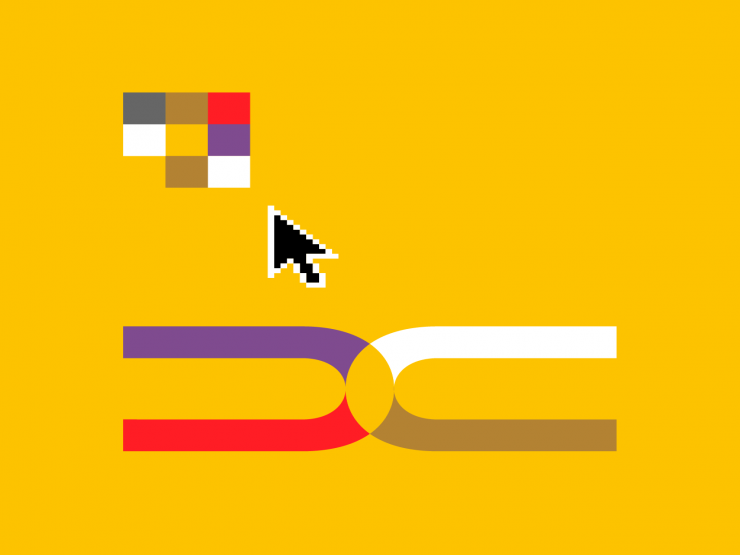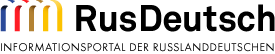Der Schriftsteller und Geologe Sergej Lebedew hat seine deutsche Familiengeschichte ausgegraben. Mit „Menschen im August“ (Fischer Verlag) wurde Sergej Lebedew in Deutschland bekannt. Er schreibt über die russischen Traumata: das Gulag-System, das Ende der Sowjetunion. Nun erforscht er den deutschen Teil seiner Familie, einer seiner Vorfahren ist Julius Schweikert.
Von Sonja Vogel
Es ist ein Haus, das aus der grauen, monotonen Reihe fällt: verspielt, mit Schnörkeln und Jugendstilelementen. Sergej Lebedew steht auf der gegenüberliegenden Straßenseite unweit des alten Arbat und schaut auf das Haus. Eine seiner Urururgroßmütter – ganz genau weiß er nicht, wie viele Generationen zwischen ihnen liegen –, eine Deutsche, hat hier mit ihrem wohlhabenden deutschen Mann gelebt. Unter ihren acht Schwestern hatte sie die beste Partie gemacht.
Der junge Schriftsteller, geboren 1981, wirkt noch immer etwas überrascht über diesen Teil seiner Familiengeschichte. Denn zwar hat Sergej Lebedew sein gesamtes Leben in Moskau verbracht, aber dass dieses Haus irgendwie zur Familie gehört, weiß er erst seit Kurzem. „Es gibt da diesen Grabstein auf unserem Familiengrab in Moskau“, beginnt Lebedew. Die Beschriftung sei lateinisch, der Name deutsch. Als Kind fragte er seine Großmutter danach und auch heute noch erinnert er sich gut an ihre Antwort: Der Mann sei ein Fremder, der nur zufällig auf einer der Familie zugeteilten Grabfläche liege.
Dass dem nicht so war, dass es sich um einen Verwandten handelte, einen Nachkommen von dem nicht unbekannten deutschen Wissenschaftler Julius Schweikert gar, erfuhr Lebedew erst als Erwachsener heraus. Jener Schweikert gilt als Mitbegründer der Homöopathie. 1837 kam er aus Leipzig ins Zarenreich, mit dem Auftrag „als Apostel der Homöopathie den wilden Osten zu erschließen“, wie Lebedew es mit einem schiefen Lächeln sagt. 1876 starb er, hinterließ acht Töchter – als „Injektion in die russischen Venen“ bezeichnet Lebedew deren Einheiraten in russische Familien.
Als Lebedew 2015 als Stipendiat des Literarischen Colloquiums in Berlin lebte, machte er sich auf die Suche nach Schweikerts, also seiner eigenen deutschen Familie. Er stieß auf ein Buch, in dem sich eine Wissenschaftlerin auf Schweikert bezog, und nahm Kontakt zu ihr auf. In Windeseile waren die Nachkommen Schweikerts gefunden. „Es war überraschend“, sagt Lebedew, „ich habe als Erwachsener eine zweite Familie bekommen.“ Seither treffen sie sich regelmäßig. Beim ersten Mal bekam Lebedew einen Familienstammbaum mit weit ausgreifenden Zweigen geschenkt – er endet mit den acht Töchtern, zu dem Zeitpunkt also, als die Schweikerts in Russland Wurzeln geschlagen hatten.
Die Großutter war die letzte, die die Geschichte kannte
Und so wurde nach 100 Jahren eine Geschichte wiederentdeckt, die Lebedews Großmutter ihren Kindern verschwiegen hatte. 1908 geboren, war sie die Letzte, die die deutsche Familiengeschichte kannte. „Mein Vater, Jahrgang 1941, wusste schon nichts mehr davon. Deutsche Verwandtschaft zu haben, war ein Risiko“, sagt der Schriftsteller. Und so wurde die Geschichte vergessen. Lebedew wird darüber seinen nächsten Roman schreiben. Ab März ist er in Berlin, wird weiter forschen.
Es ist erstaunlich, dass die Eltern, beide Geologen, die sich ihr Leben lang damit beschäftigten, in Sibirien nach der großen Geschichte zu graben, nicht durch die Oberfläche der eigenen Familiengeschichte stießen. Auch das hat Lebedew in seinen Romanen verarbeitet, denn Vater und Mutter waren unter den ersten Geologen, die in den von ehemaligen Strafgefangenen ausgehobenen Schächten arbeiten konnten – oft mit der Hilfe frei gelassener Gulag-Häftlinge. Als er ein Kind war, war das kein Thema, erinnert sich Lebedew. „Es war einfach nicht die Zeit des Reflektierens“, sagt Lebedew über die letzten Jahre der Sowjetunion.
Und nun versucht er, einer aus der Generation der 90er, die von Revolution und Krieg, von der ganzen Brutalität des 20. Jahrhunderts aufgerissen Löcher wieder zu stopfen. Aber sie sind zu groß. „Es ist unmöglich, eine Familiensaga zu schreiben. Mein Roman wird also einer über die Unmöglichkeit eines Romans“, sagt Lebedew.
Der Roman setzt mit dem Aufbruch im August 1991 ein
Auch in seinem aktuellen Roman, „Menschen im August“, der im Herbst bei Fischer erschienen ist, hat er das schon versucht. Das Buch kreist weit um die Stalinzeit, beschreibt die verkasteten Landschaften der Überlebenden – jene in Sibirien, genauso wie die metaphorischen in ihrem Inneren. Der Roman setzt ein im August 1991, beginnt mit dem Aufbruch und endet mit Putins Regierungsantritt. Es ist trotz der Hoffnungslosigkeit ein schönes Buch, die bildreiche Sprache beißt sich angenehm mit den historischen Fakten.
In Russland kommt das Buch erst in diesen Tagen heraus, also nach der deutschen Übersetzung. Lebedew hatte zwei Jahre nach einem russischen Verlag gesucht, denn die Verlage sind vorsichtig geworden, wenn es um die neuere russische Geschichte geht. Nun ist er bei „Alpina“ gelandet. „Die verlegen auch Chodorkowski und haben nichts zu verlieren“, sagt Lebedew und lacht. Trotzdem strich man ihm Adolf Hitlers „Mein Kampf“ aus dem langen Literaturverzeichnis. Zur Sicherheit.
Lebedew war als Geologe acht Jahre am Ural
2011, als Lebedew seinen ersten Roman veröffentlichte, eine von seinen Eltern inspirierte Gulag-Geschichte, war die Stimmung noch anders. „Der Himmel auf ihren Schultern“ (Fischer, 2013) wurde nach seinem großen Erfolg in Russland sogar vom Großverleger „Eksmo“ nachgedruckt. „Wir dachten damals, das Thema müsste einschlagen wie eine Bombe“, erinnert sich Lebedew. So war es aber nicht. „Es war die letzte Chance für mich als Autor, aber eigentlich zu spät für eine Veröffentlichung“, sagt er nun.
Sergej Lebedew ist übrigens selbst Geologe. Ganze acht Jahre verbrachte er mit Ausgrabungen. Dann war es Zeit für etwas Neues und er begann zu schreiben. Als Kind der 90er hatte er das Gefühl, sich mitteilen zu müssen – zuerst als Journalist, dann als Schriftsteller. Das Motto seiner Arbeit sei eigentlich die Erklärung der Geburt von Putins Russland, meint der Schriftsteller. Ob ihm das geglückt ist? Das weiß er nicht.
Aber er hat einige Erkenntnisse aus der Arbeit gezogen. „Meine Generation ist schnell erwachsen geworden, wir mussten die Realitäten schneller begreifen als unsere Eltern“, sagt Lebedew. Seither hat sich Russland verändert, auch durch die neue Wirtschaftskrise. Das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern habe sich umgekehrt: „Nun sind wir die Jungen, weil uns die Überlebenstricks aus der Sowjetunion fehlen.“ Aber die Aufbruchsstimmung, die Lebedew in den 90ern verspürte, ist dahin. Fast alle seine Freunde seien schon im Ausland. Sergej Lebedew denkt noch nicht ans Auswandern. Aber wer weiß, schließlich hat er auf seine Weise in Deutschland neue Wurzeln geschlagen.