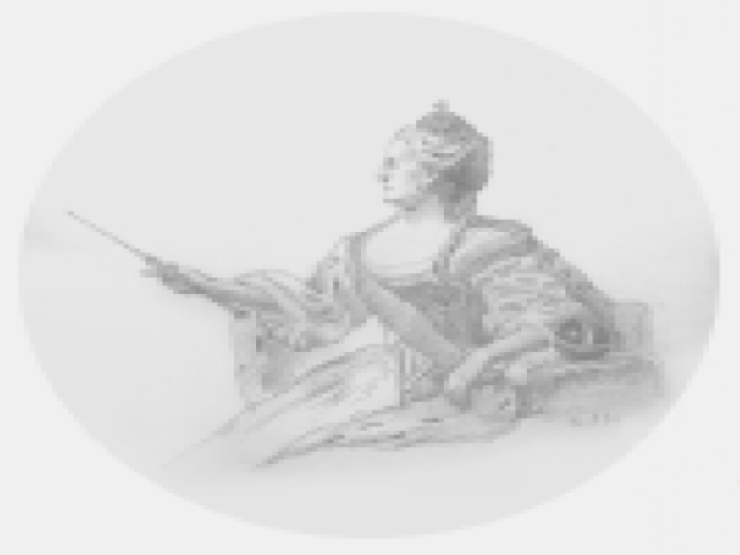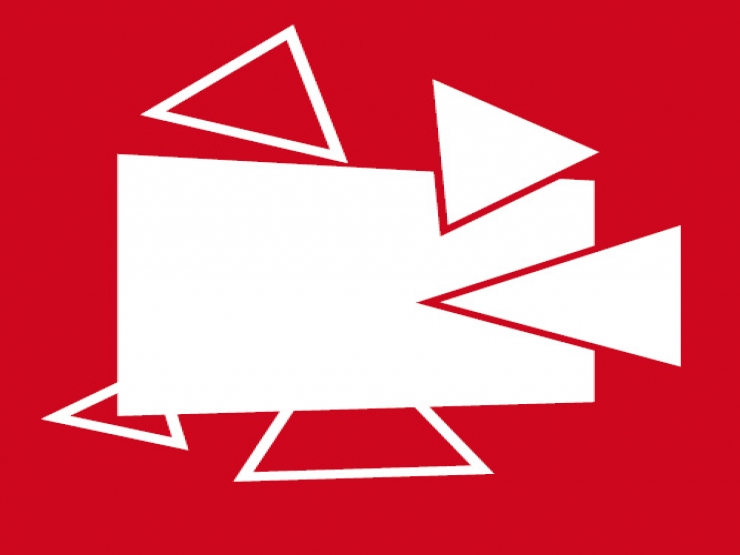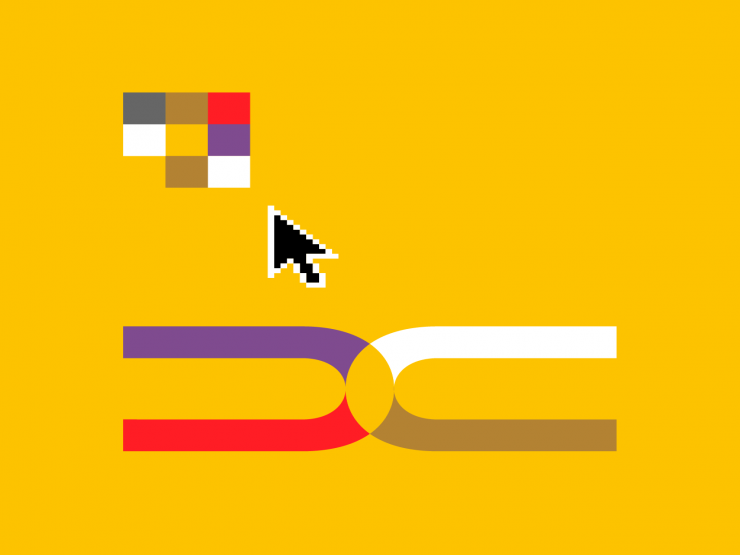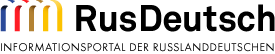Ex-Olympiasieger Dawyd Riegert ist „herausragender Deutscher“ 2016.
Er hat wieder einmal gewonnen, wie so oft in seiner Karriere: Dawyd Riegert, 69, ehemaliger Weltklasse-Gewichtheber, ging aus der Abstimmung zu „Russlands herausragenden Deutschen“ 2016 als Sieger in der Kategorie Sport hervor. Im Interview spricht er über seine deutschen Wurzeln, Misserfolge und Doping in Russland.
Herr Riegert, was würden Sie dazu sagen, wenn wir – Sie als Deutscher aus Russland, ich als Deutscher aus Deutschland – dieses Interview auf Deutsch führten?
Lieber nicht! Zu den Lebzeiten meiner Eltern haben wir zu Hause schon auch Deutsch gesprochen. Aber heute bin ich ehrlich gesagt etwas aus der Übung.
Sie wurden 1947 in einer deutschen Familie geboren, aber tausende Kilometer von der Heimat entfernt.
Ja, in Nordkasachstan. Dorthin waren meine Eltern 1941 im Zuge der Umsiedlung der Sowjetdeutschen verbannt worden. Von meinen acht Geschwistern haben zwei die Fahrt nicht überlebt. Es herrschte ja Krieg, und es war ein langer Transport in Viehwaggons.
Ursprünglich stammt Ihre Familie aus Südrussland.
Aus Friedental, einem der deutsch besiedelten Orte am Fluss Kuban. Mein Vater und meine Mutter sind im selben Hof aufgewachsen. Mein Großvater väterlicherseits war Verwalter bei meinem Großvater mütterlicherseits, einem Baron. Meine Mutter, die mit Mädchennamen Horn hieß, war adliger Herkunft. Ihre Vorfahren sind in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts nach Russland eingewandert. Von wo genau, hat man mir 2002 bei einem Besuch in Süddeutschland gezeigt. Da bin ich dann durch diesen Ort gelaufen und hatte den Eindruck: Hier warst du schon mal. Vieles kam mir vertraut vor, bis hin zum Essen.
Was glauben Sie, was an Ihnen deutsch ist?
(Überlegt) Nun, zumindest der Eintrag der Nationalität im Pass. Und damit mich keiner aufzieht, was ich denn für ein Deutscher bin, achte ich darauf, dass bei mir immer Ordnung herrscht.
Was haben Sie für Erinnerungen an die Gegend, wo Sie groß geworden sind?
Ein Flecken namens Nagornoje. Da gab es zunächst überhaupt nichts, nur nackte Steppe. Und Menschen von überall her: aus dem Kaukasus, aus dem Fernen Osten. Die haben dort einen Sowchos aufgebaut und in der Neulandgewinnung gearbeitet. Man konnte dabei gutes Geld verdienen. Mit der Zeit sind dann alle in ihre Heimatgegenden zurückgekehrt, wir 1964 zurück an den Kuban.
Hat die Erfahrung der Vertreibung in Ihrer Familie Spuren hinterlassen in Form von Angst vor der Obrigkeit?
Nein, die Angst ist vergangen. Ein Leben in Angst ist doch überhaupt kein Leben.
Hat sich Ihre Nationalität in irgendeiner Weise auf Ihren weiteren Werdegang ausgewirkt?
Ich kann mich nicht an Nachteile erinnern, wenn Sie das meinen, weder bei mir noch bei meinen Geschwistern. Als Kinder haben wir uns deshalb manchmal geprü- gelt. Aber später hat das eigentlich keine Rolle mehr gespielt.
In den 90er Jahren sind die meisten Russlanddeutschen als Spätaussiedler nach Deutschland gegangen. Haben Sie das für sich auch in Erwägung gezogen?
Ich hatte schon vorher Angebote aus dem Westen, zunächst als Sportler, dann als Trainer. Aber dann war ich mal einen Monat in Deutschland zu Besuch und habe verstanden, dass das nichts für mich ist. Das war alles so ungewohnt, da hätte ich mich komplett umstellen müssen. Und dann: Generationen meiner Familie hatten in Russland gelebt. Warum sollte ich wegziehen?
Was war das damals für eine Zeit für Sie?
Ende der 80er Jahre war ich sowjetischer Nationaltrainer im Gewichtheben. In den schwierigen 90er Jahren hatte ich das eine oder andere Business. Dann bin ich wieder Nationaltrainer geworden. In Taganrog in der Region Rostow am Don habe ich eine Nachwuchsschule im Gewichtheben eröffnet, die heute eine Akademie ist. Die Kinder können dort kostenlos ihrem Sport nachgehen. Inzwischen habe ich auch eine kleine Landwirtschaft auf zwölf Hektar. Mein Leben war immer von Anstrengungen geprägt, aber auch ein sehr interessantes Leben.
Jetzt will ich endlich zu Ihrer erstaunlichen Laufbahn als einer der besten Gewichtheber aller Zeiten übergehen. Stimmt es, dass Sie erst nach der Rückkehr aus Kasachstan, also mit 17 Jahren, zum ersten Mal eine Gewichtheberstange in der Hand gehalten haben?
Sogar erst mit 19 Jahren, zwei Monate vor der Einberufung zum Wehrdienst. Aber natürlich hatte ich vorher schon Sport getrieben: Boxen, Leichtathletik. Immer solange, bis es in meinem Umfeld keinen Besseren als mich gab. Von den Männern in meiner Familie bin ich der kleinste, dafür hat mich Gott mit Kraft gesegnet. Und ich habe mich revanchiert, indem ich etwas aus mir gemacht habe.
Wie konnten Sie es im Gewichtheben zu etwas bringen, nachdem Sie so spät damit angefangen hatten?
Da bin ich wahrscheinlich ein absoluter Sonderfall. Aber ich hatte ein lebendes Beispiel vor Augen. Mein Trainer Rudolf Pflugfelder war 1964 im Alter von 36 Jahren Olympiasieger geworden. Der hat mir vorgemacht, dass es nie zu spät ist, wenn man die nötigen Voraussetzungen mitbringt. Und ich habe gleich zum Einstand 200 Kilometer bis zu den Knien hochgewuchtet, war körperlich einfach in guter Verfassung. Niemand konnte grö- ßere Trainingsumfänge aushalten als ich.
Auf welche Leistung in Ihrer Karriere sind Sie besonders stolz?
Ins Gedächtnis gebrannt haben sich eher die Misserfolge als die Erfolge, an die ich mich gewöhnt hatte. Von drei Olympischen Spielen, bei denen ich jedes Mal haushoher Favorit war, habe ich nur eine gewonnen und zweimal versagt. Aber wer weiß, wozu das gut war. Die größte Schwäche des Menschen ist der Hochmut. Scheinbar wollte es Gott so, dass ich hübsch auf dem Boden bleibe.
Vor Kurzem war wieder Olympia, diesmal in Rio. Haben Sie die Wettkämpfe verfolgt? Wie fanden Sie das Niveau?
Ja, ich habe am Fernseher gesessen. Das Niveau war in Ordnung, auch wenn viele der Besten gefehlt haben. Im Gewichtheben ist die Konkurrenz ja ungeheuer groß. Zu meiner Zeit haben weniger als 50 Landesverbände ihre Sieger ermittelt, heute sind es um die 200. Alle wollen im Gewichtheben mitmischen. Vielleicht gibt es deshalb auch mehr Skandale als anderswo.
Die russischen Gewichtheber waren wegen Dopingvorwürfen kollektiv von den Spielen ausgeschlossen. Was sagen Sie dazu?
Den Starken versucht man immer an den Karren zu fahren. Das war früher nicht anders. Mit Russland geht man heute so um wie damals mit der Sowjetunion, da werden besondere Maßstäbe angelegt. Mir hat nicht gefallen, wie die Politik sich der Olympiade bemächtigt hat. Da sind viele Schweinereien passiert, nicht nur in unserem Sport.
Sie sind nicht der Auffassung, dass Russland ein Dopingproblem hat?
Doch. Es gibt Probleme. Und wer gegen die Dopingregeln verstößt, muss bestraft werden. Aber doch nicht eine gesamte Nation! Zudem weiß ich natürlich, wie in anderen Ländern und anderen Verbänden gearbeitet wird.
Dopingsünder gibt es überall?
Genau! Und in etwa in denselben Proportionen zur Gesamtzahl der Sportler.
Wie schwer wiegt es für das russische Gewichtheben, die Olympiade verpasst zu haben?
Das ist nicht tödlich. Und was uns nicht umbringt, macht uns stärker.
Das Interview führte Tino Künzel. Der Artikel erschien bei der Moskauer Deutschen Zeitung.