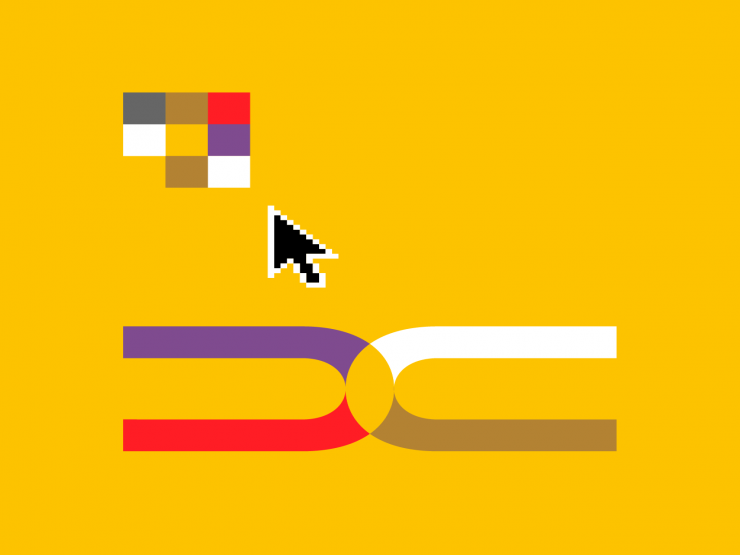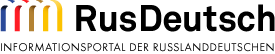Als Spätaussiedler akzeptiert in Deutschland? Ein Betroffener berichtet.
Fußballstar Mesut Özil hat Teilen der deutschen Gesellschaft in einem Brandbrief latenten Rassismus attestiert und damit sowohl Zustimmung als auch Widerspruch geerntet. Selbst Menschen mit Migrationshintergrund sind durchaus geteilter Meinung. Hier erzählt der Russlanddeutsche Wladislav Miller, geboren in Sibirien, von seinen Alltagserfahrungen. Der heute 29-Jährige ist Webdesigner bei einer Kommunikationsagentur in Hannover.
Ich habe einen russischen Vornamen, spreche aber nicht mit Akzent. Das verwirrt die Leute. Also fragen sie: Und woher kommst du? Ich bin in Komsomolsk am Amur geboren, mit meiner Familie Anfang der 90er Jahre als Russlanddeutscher nach Deutschland übergesiedelt, antworte ich dann. Manchmal lautet die nächste Frage, was ich wohl von Putin halte. Viele sind sogar erstaunt, wenn ich mich dann distanziere.
In der Schule war mir mein Name peinlich, zwischen den ganzen Jakobs und Toms. Ich hatte das Gefühl, anders behandelt zu werden. „Waldeslaus“ oder „Fladenbrot“ haben sie mich genannt. Später habe ich mich manchmal sogar als Michael vorgestellt, wenn ich keine Lust auf so etwas hatte.
Pelmeni und „Du musst jetzt gehen“
Ich war nie ein Außenseiter, aber damals hatte ich vor allem russische Freunde. Ich bin mit ihnen besser klar gekommen. Wenn wir zusammen gespielt haben, haben unsere Mütter uns Pelmeni gekocht. Ich habe mich bei ihnen zu Hause gefühlt. Bei den deutschen Familien hieß es stattdessen: „Wir essen zu Mittag, du musst jetzt gehen‘‘, und dann bin ich halt gegangen. Ich glaube, wenn ich mich bemüht hätte, hätte ich auch mehr mit den anderen Kindern anstellen können. Aber ich habe einfach nicht die Notwendigkeit darin gesehen. Die anderen haben nichts falsch gemacht, es hat nur nicht gepasst. Warum etwas erzwingen? Andersherum habe ich allerdings gerne deutsche Freunde mit zu mir genommen und war auch irgendwie stolz, ihnen unsere Welt zu zeigen.
Oft kam sogar Lob, weil sie sich bei uns wohlgefühlt haben. In der Berufsschule hatte ich mal einen Lehrer, der mich fragte, ob ich nicht lieber zurück in meine Heimat gehen wolle — und wirklich schlecht benotet hat. Danach habe ich aber kaum Rassismus-Erfahrungen mehr gemacht. Es gibt Kleinigkeiten, die ich allerdings nicht als ausländerfeindlich empfinde. Ich glaube, dass die Leute meist unbewusst ins Fettnäpfchen treten, wenn sie zum Beispiel sagen, dass ich gut Deutsch spreche. So etwas könnte mir vielleicht im Verhältnis zu Personen mit Behinderung passieren. Da steckt keine böse Absicht dahinter. Viele Menschen mit Migrationshintergrund erzählen von schlechten Erfahrungen. Ich sehe es so: Wenn ich eine Wohnung nicht bekomme oder nicht in eine Disco gelassen werde, dann ist es vielleicht auch besser so. Mit solchen Personen möchte ich erst gar nichts zu tun haben.
Wenn „die Deutschen“ zu Russen werden
Für die Deutschen sind wir einfach Russen. Meine Eltern haben es dabei viel schwerer, aus diesem Klischee herauszukommen. Manche sehen nur Ausländer, die sich nicht integrieren wollen und nicht so gut Deutsch sprechen. Dabei sind sie sehr westlich eingestellt. So westlich, dass sie in Russland als „die Deutschen“ galten. Es ist kompliziert, das zu erklären. Ich würde mich nicht als Russen und auch nicht als Russlanddeutschen beschreiben.
Ich sehe mich als Deutschen mit Vorteil, dessen Horizont weiter ist, weil er mehr gesehen hat. Ich weiß, dass es zwei Seiten der Medaille gibt. Mir würde zum Beispiel nicht im Traum einfallen, mich rassistisch zu äußern. Das ist aber auch kein Thema, das mir im Alltag begegnet. Höchstens mal, wenn ich neue Leute kennenlerne. Inzwischen stört es mich auch kaum noch, wenn ich meinen Namen fünfmal sagen muss. Irgendwann klappt es schon.
Der Artikel erschien in der Moskauer Deutschen Zeitung 15/2018.