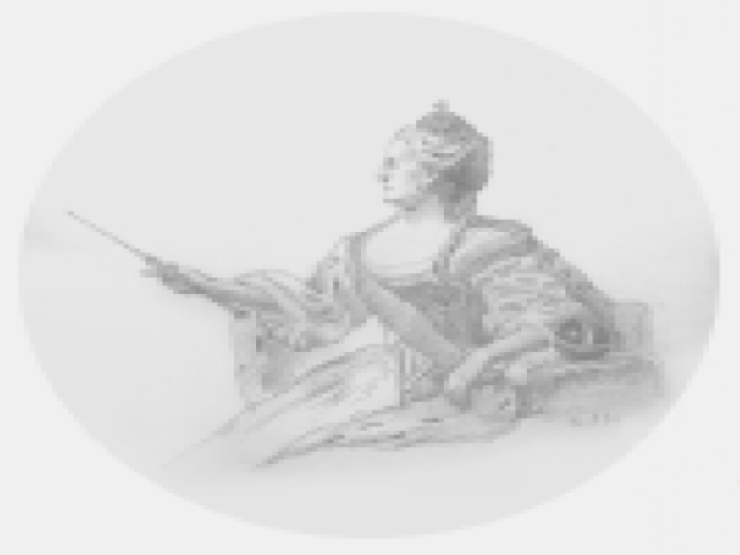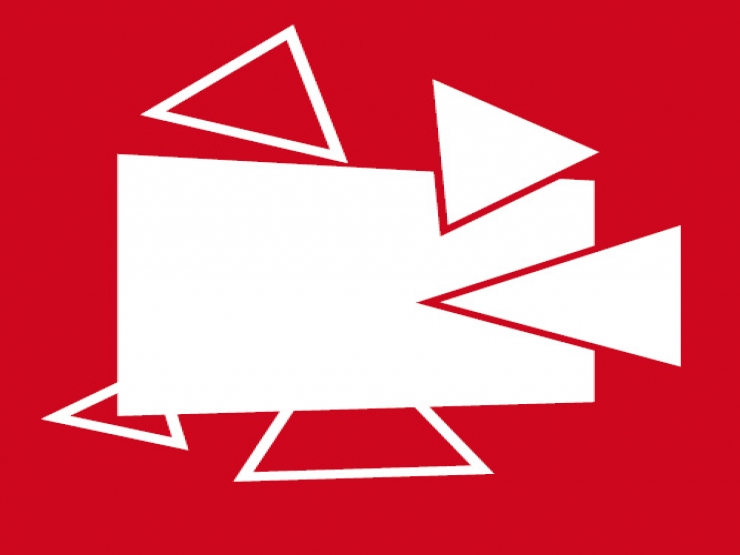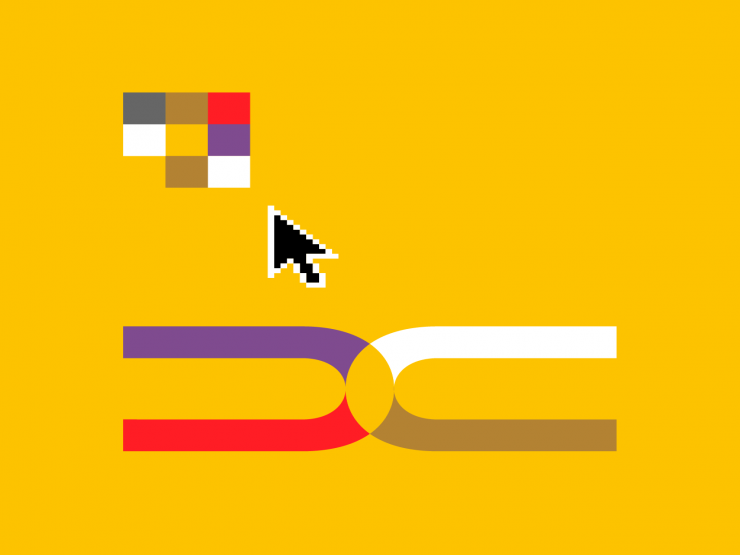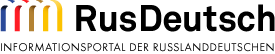Als man den Einwohnern von Lipowka auch noch die Kirchglocke nehmen wollte, gingen sie zum Widerstand über. Ein Beitrag der Moskauer Deutschen Zeitung.
Lipowka und Podstepnoje in der Oblast Saratow trugen früher deutsche Namen: Schäfer und Rosenheim. Dort lebten Wolgadeutsche, bevor sie 1941 als angebliche Nazi-Kollaborateure nach Osten deportiert wurden. Was heute noch in den Dörfern steht, sind ihre Kirchen, schwer mitgenommen durch die Sowjetzeit und die Verwahrlosung danach. So langsam beginnen auch die Einheimischen, Anteil ihrem Schicksal zu nehmen.
Man schrieb den 20. Januar 2017, als im schönsten Schneetreiben plötzlich ein Kranwagen vor der Kirche in Lipowka auftauchte und seinen Teleskoparm ausfuhr. Der eine oder andere Dorfbewohner rieb sich um 9 Uhr morgens gerade noch den Schlaf aus den Augen, doch im Handumdrehen war der gesamte Ort hellwach. So nahm die „Schlacht“, wie sich die Ortsansässigen ausdrücken, ihren Lauf. Unterfangen war von der Kreisverwaltung angeordnet worden. wollte die Kirchglocke demontieren lassen, angeblich sicherheitshalber.
Bevor sie jemandem auf den fällt. Es soll Beschwerden aus Bevölkerung gegeben haben. habe die Glocke anschließend Museum bringen wollen, die Beamten. Diese Begründung wurde erst später nachgeschoben. Als die Technik an diesem Wintertag vorfuhr, war niemand gefragt oder wenigstens informiert worden. Scheinbar hatten die Behörden nicht damit gerechnet, dass Ruine und alles, was damit verbunden ist, den Dörflern irgendetwas bedeuten könnte. Und dass auch dem Dorf so etwas wie eine Zivilgesellschaft existiert, die sich zu organisieren weiß. Lipowka stellte an jenem Freitag im wahrsten des Wortes quer. Die Demontage musste abgeblasen werden.
Sogar die überregionale Presse hat diesen unerhörten Vorfall vor acht Monaten aufgegriffen. Denn das russische Dorf ist eher nicht dafür bekannt, gegen die Staatsmacht aufzubegehren. Hier ist der Rückhalt für Wladimir Putin besonders hoch, hier verfängt die Ideologie der "traditionellen Werte" am leichtesten. Wenn sich in Russland etwas regt, dann fast ausschließlich in den großen Städten, wo das Bildungsbürgertum zahlreich vertreten ist. Das Dorf gilt vor allem als Ort, wo man leicht den Glauben verlieren kann. Daran, dass noch alles gut wird. Dass das ländliche Russland nicht ausblutet. Dass die Besten bleiben. Oder wiederkommen. Lipowka wurde 1766 als wolgadeutsche Kolonie Schäfer gegründet. Die lutherische Kirche ist Baujahr 1905. Eine „Kommission für religiöse Fragen“ in der sogenannten Wolgarepublik, der deutschen Autonomie in der jungen Sowjetunion, verfügte 1935 ihre Schließung. Politisch korrekt wurde das damit motiviert, dass sich von 485 Gemeindemitgliedern 402 selbst dafür ausgesprochen hätten. Im Kirchenschiff wurde eine Traktorenwerkstatt eingerichtet und zu diesem Zweck eine große Öffnung in die rückwärtige Wand gehauen, damit die Fahrzeuge hindurchpassten. Als die Sowjetunion das Zeitliche segnete, hatte man auch für die Werkstatt keine Verwendung mehr. Das Gebäude war fortan sich selbst überlassen und verfiel immer mehr.
Fragt man die Einheimischen heute, wieso sie für eine Kirche Partei ergreifen, die keiner von ihnen je als Kirche erlebt hat, sagen sie viel Kluges und Wichtiges. Manchmal wird es auch etwas mystisch. Die Geschichten handeln von Glaube und Schicksal. Und davon, dass noch alles gut wird. Wenn die Schaulustigen, die Lipowka wegen seiner Sehenswürdigkeit von der traurigen Gestalt in Scharen besuchen, Glück haben, dann treffen sie als erstes auf Tatjana Lukaschewa (siehe Kommentar rechts) oder auf Sergej Kowtunow.
Den ersten guten Rat gibt ihnen der ehemlaige Schuldirektor und heutige Frührenter bereits, wenn sie ihre Fotoapparate zücken: "Fotografieren Sie das Gebäude lieber von der anderen Seite, da sind keine Stromkabel im Weg." Kowtunow teilt aber auch gern all die Erlebnisse, die ihn mit der Kirche verbinden. Berichtet von der "unglaublichen Aura", die dort herrscht, dass einem "ganz komisch" wird, wenn man das Gerippe betritt. Klärt auf, dass es sich um die größte aller zumindest in diesem Zustand erhalten gebliebenen deutschen Kirchen im Wolgagebiet handelt und die einzige, die noch über eine alte Glocke verfügt. Das habe immer wieder Begehrlichkeiten geweckt. Von Banditen bis zu Geistlichen hätten über die Jahre diverse Auswärtige ein Auge auf die Glocke geworfen und stets eine Abfuhr bekommen. Kowtunow selbst ist von Beruf Physiker und war nach eigenen Worten nie besonders religiös, aber dann ist ihm etwas passiert, das er sich bis heute nicht erklären kann. Am Vorabend einer Krebsoperation hat er von lutherischen Geistlichen geträumt, die sich über seinen Körper beugen. Am Morgen war er bester Dinge und voller Optimismus. Warum, wollte er aber seinem behandelnden Arzt lieber nicht verraten: „Sonst schickst du mich in die Klapsmühle.“ Der vermeintliche Krebs habe sich dann als gewöhnliche Hämorrhoiden herausgestellt. Die Ärzte seien fassungslos gewesen. Und die Moral von der Geschichte? Kowtunow, orthodoxer Christ, formuliert sie so: „Wir haben alle denselben Gott, auch wenn wir unseren Glauben unterschiedlich leben.“ Die Kirche in seinem Dorf nicht nur vor künftigem Raubbau zu beschützen, sondern sie wieder aufzubauen, bezeichnet der freundliche, leise ältere Herr als seine „Lebensaufgabe“: Er wolle es noch erleben, dass sie zumindest wieder Fenster und ein Dach habe, so wie in seiner Kindheit. Lipowka könnte auch Ust-Solicha (Messer) heißen. Oder Priwolnoje (Warenburg). Überall dort ragen die Turmstummel lutherischer Kirchen anklagend in den Himmel, nehmen sich die eins so stolzen Bauten aus wie verwunschene Märchenschlösser inmitten der geduckten Dorflandschaften. Von hunderten evangelischen und katholischen Kirchen in der Wolgarepublik gehören sie zu den wenigen, die überlebt haben.
In Podstepnoje, dem deutschen Rosenheim, wurde der Turm der Kirche schon in den 30er Jahren abgetragen. Der massive Bau mit dem Säulenportal diente bis in die postsowjetischen Jahre hinein als Dorfklub, so mancher schwärmt nochheute von der Akustik, die Bühnenauftritte dort zu einer Freude machten. Doch die Mädchen, die vor dem Lebensmittelladen gegenüber in ihre Spiele vertieft sind, wissen schon, was das in Wahrheit für ein Gebäude ist: "eine verfallene Kirche", "eine deutsche Kirche", "ich war da mal mit meiner Oma drin, die kannte die Räumlichkeiten noch von früher".
In den 90er Jahren, als jeder sehen musste, wie er über die Runden kommt, und teils montelang keine Löhne gezahlt wurden, wollte es sich die Dorfverwaltung nicht mehr leisten, den Klub zu beheizen. Dann schmissen Vandalen die Scheiben ein. Heute sind die Wände mit Graffiti beschmiert, im besten Falle mit Liebesbekenntnissen. Junge Leute aus dem nahen Saratow haben hier einen Gruselfilm gedreht, mit Vampiren und so. Vor drei Jahren hat sich ein Junge in der Kirche erhängt.
Aber so langsam scheint sich nicht nur der Ort zu fangen, sondern auch ein Bewusstsein dafür zu entstehen, was man an diesem Bau hat. Der Innenraum wirkt heute durchaus aufgeräumt, deutsche Freiwillige sorgen im Rahmen von Workcamps regelmäßig für Ordnung. Schüler der benachbarten Schule kümmern sich darum, dass das Außengelände nicht verwildert. Dafür, dass es überhaupt so weit gekommen ist, trage niemand die Schuld außer den Einheimischen, sagt Georgij Kessler, dessen deutschstämmige Großeltern aus der Gegend stammen und der in den 70er Jahren mit seiner Familie aus der Verbannung heimgekehrt ist: "Wir lieben es ja, die Fehler bei anderen zu suchen. Aber das waren wir alles selbst". Nun müsse man auch selbst etwas tun, um die Kirche von ihrem Dasein zu erlösen. Kessler hat sich ausgiebig mit ihrer Gechichte beschäftigt, weiß von einer verschollenen Bibliothek und von einem Keller, wo sich die Bewohner einst vor Angriffen der Steppenvölker versteckt hätten.
Heute schreibt er Petitionen, darunter auch bis nach "ganz oben", wirbt um Untersützung. Er könnte sich sein Dorf nicht ohne die deutsche Kirche vorsellen, erklärt er. Das scheint immer mehr Menschen so zu gehen.
Quelle: Moskauer Deutsche Zeitung Nr. 17(456).