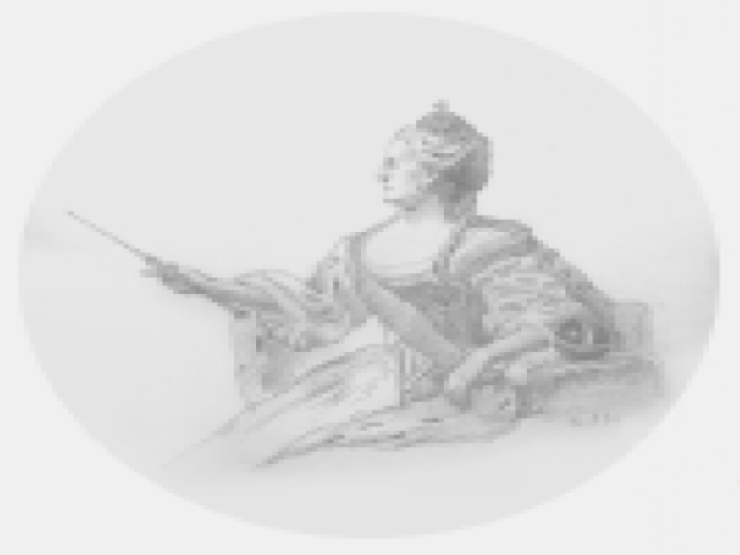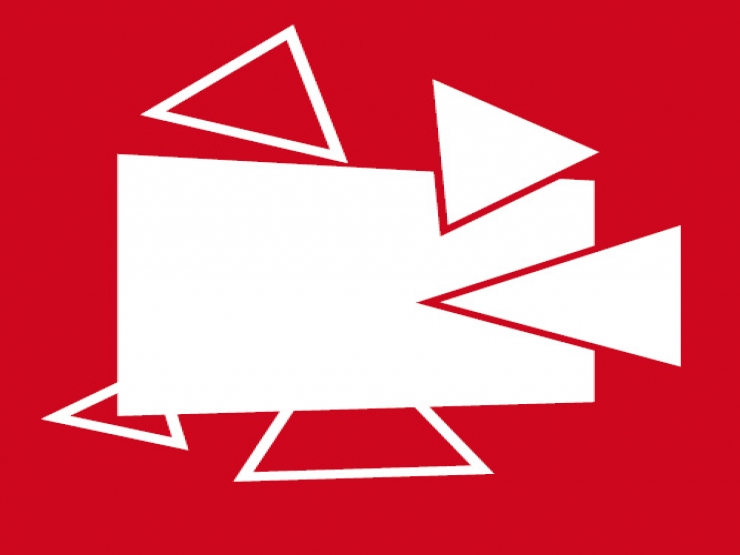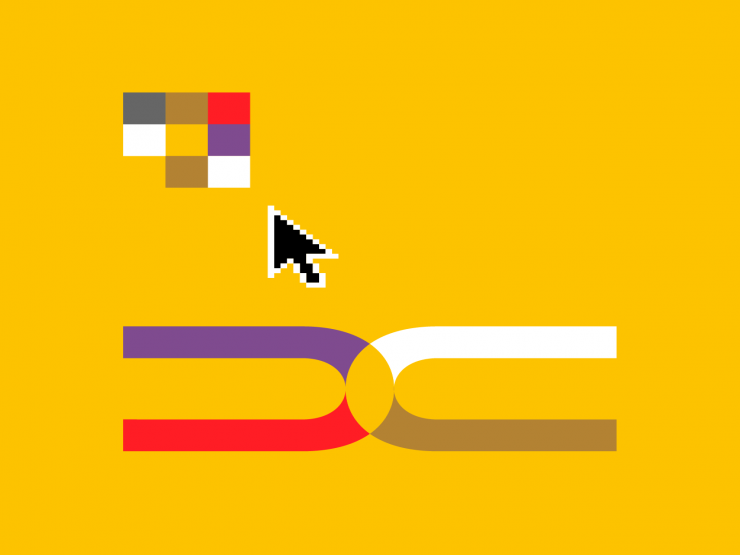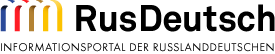Nikolaj Gernet ist ein Fotograf aus Archangelsk, der sowohl als Gewinner als auch als Finalist zahlreicher russischer und internationaler Wettbewerbe hervorgetreten ist. Er hat an vielen Expeditionen teilgenommen und arbeitet im Nationalpark „Russkaja Arktika“ (dt.: Russische Arktis). Neben seiner Tätigkeit vor Ort hat Nikolaj in Archangelsk seine eigene Fotoschule gegründet, in der jedes Jahr Dutzende von Menschen lernen, die Welt durch den Sucher der Kamera neu zu entdecken. In einem interessanten Gespräch teilte Nikolaj mit uns die Geschichte seiner Familie sowie den Beginn seiner Karriere. Er gab Einblicke in die Besonderheiten der Arbeit unter extremen Bedingungen und erzählte uns von der herzlichen Beziehung, die er zu seinen Schülern pflegt.
Was waren Ihre Kindheitsträume? Hatten Sie schon früh den Wunsch, Ihr Leben mit Kreativität zu verbinden, oder entwickelte sich diese Leidenschaft erst im Laufe der Zeit?
Ich habe einen Onkel, der entweder 2. oder 3. Grades ist. Wenn er uns in unserer Kindheit besuchte, kam er stets in einem teuren Auto, begleitet von seiner Frau, die in eleganten Kleidern gekleidet war. In der Sowjetunion war das eine Seltenheit; die meisten Menschen lebten bescheiden. Als ich fragte: „Was macht unser Onkel beruflich?“, wurde mir gesagt, dass er als Bergmann tätig sei. Es war offensichtlich, dass er nicht im Bergwerk arbeitete, sondern als Chef der Bergleute fungierte. Dennoch wurde mir immer versichert, er sei ein Bergmann. In meiner kindlichen Vorstellung wollte ich ebenfalls Bergmann werden, um eines Tages ein schönes Auto und schicke Kleider zu besitzen. So äußerte ich oft den Wunsch, diesen Beruf zu ergreifen.
Später, wie viele andere sowjetische Kinder, träumte ich plötzlich davon, Polizist zu werden. Meine Familie ist stark medizinisch geprägt: Meine Mutter ist Ärztin und wir hatten zahlreiche Ärzte in unserem Bekanntenkreis. Mein Vater arbeitete in einem Unternehmen mit medizinischem Bezug. Als Kind verbrachte ich viel Zeit im Krankenhaus, wo meine Mutter arbeitete. Dann begann mein Bruder mit dem Medizinstudium, doch trotz dieser familiären Tradition verspürte ich nicht den Drang, ebenfalls Arzt zu werden. Ich beobachtete die Herausforderungen und den Stress, die mit diesem Beruf und dem Studium meines Bruders verbunden waren. Da ich eher humanitär veranlagt bin und in Archangelsk damals keine Fakultäten für Journalismus oder Psychologie existierten, entschied ich mich für ein Studium der Sozialarbeit. Es mag zwar wie ein Medizinstudium erscheinen, doch es fand an der Fakultät für Sozialarbeit statt.
Eines Tages, während meines zweiten Lehrjahres, schlenderte ich an der Redaktion der Universitätszeitung vorbei. Ich blickte in das Büro und sagte: „Mir gefällt es nicht, wie die Zeitung derzeit aussieht“. Die Redakteure schauten mich an und sagten: „Es gefällt Ihnen nicht? Kommen Sie rein, setzen Sie sich und gestalten Sie sie so, wie es Ihnen gefällt“. So begann meine Reise bei der Universitätszeitung, die mich ab dem zweiten Lehrjahr begleitete. Ich durchlief alle Facetten des Journalismus: Zunächst kümmerte ich mich um das Layout der Zeitung, bevor ich schließlich eigene Artikel verfasste. Dank meiner Großmutter, die Lehrerin für russische Sprache und Literatur war, hatte ich nie Schwierigkeiten mit der Sprache oder dem schriftlichen Ausdruck meiner Gedanken. Ich schrieb Artikel, arbeitete kurzzeitig beim Radio und sammelte Erfahrungen im Fernsehen. Parallel dazu entwickelte sich mein Interesse an der Fotografie. Mein Vater war zwar kein professioneller Fotograf, aber in unserer Familie gab es eine Kamera. Er liebte es zu fotografieren und ging auf Wanderungen. So wurde ich in die Kunst der Fotografie eingeführt; wir entwickelten, druckten und hängten unsere Bilder zum Trocknen zu Haus auf. Als ich schließlich mein Studium abschloss, stellte sich mir die Frage, wie ich meinen Lebensunterhalt bestreiten sollte – mein Gehalt reichte kaum aus, um die Fahrtkosten zu decken. Welche meiner Fähigkeiten konnte ich monetarisieren? Es stellte sich heraus, dass die Fotografie am lukrativsten war und stark nachgefragt wurde. Ich wurde für Shootings engagiert und fand schnell Gefallen daran, mit privaten Aufträgen Geld zu verdienen. So stieg ich in dieses Geschäft ein.
Was hat Sie dazu inspiriert, sich der Landschaftsfotografie zuzuwenden?
Die Landschaftsfotografie trat etwas später in mein Leben, denn wie in jedem kreativen Beruf besteht die Gefahr, schnell auszubrennen. Man kann zwar schöne Mädchen fotografieren, Hochzeiten festhalten oder an verschiedenen Meetings und offiziellen Veranstaltungen teilnehmen, doch irgendwann wird all das eintönig. In der Landschaftsfotografie fand ich die perfekte Verbindung meiner beiden großen Leidenschaften: dem Reisen und der Fotografie. Diese Art der Arbeit ermöglichte es mir, das Angenehme mit dem Nützlichen zu vereinen.
Reisen ist wunderbar, aber Reisen auf Kosten anderer ist noch viel besser – so wurde die Landschaftsfotografie zu meinem Weg.
Wie es in vielen Motivationssprüchen heißt: „Tu, was du liebst, und du musst nie wieder arbeiten“. Ganz so einfach ist es natürlich nicht, aber letztendlich habe ich den Weg gefunden, der mich zu dem führte, was ich wirklich tun wollte: arbeiten und gleichzeitig die Welt zu bereisen.
Das ist wirklich eine Seltenheit! Ein persönliches Hobby mit der Arbeit zu verbinden und dafür auch noch bezahlt zu werden. Haben Sie Ihre Leidenschaft für das Wandern und Reisen von Ihrem Vater geerbt, ebenso wie Ihre Begeisterung für die Fotografie?
Alles verdanke ich meiner Familie. In meiner Kindheit erinnere ich mich lebhaft daran, wie mein Vater mit seinen Freunden zu uns kam, um eine Kajaktour zu planen. Die Kajaks wurden zunächst zu Hause ausgelegt und geprüft, während große Rucksäcke und allerlei Sachen gepackt wurden. Nach der Fahrt kehrten die älteren Männer zu uns nach Hause zurück. Sie rochen nach Lagerfeuer und waren voller Geschichten – wer von einer Schlange gebissen wurde, wer umgekippt ist. Für ein Kind war das ein lebendiges Spektakel. Man wollte so sein wie der Vater, seine Anerkennung erlangen. Diese Erlebnisse haben den kleinen Nikolaj geprägt und ihn zu dem gemacht, der ich heute bin. Solche Beispiele sind ansteckend. Ich wurde oft auf verschiedene Wochenendausflüge mitgenommen, und obwohl nichts Übernatürliches geschah, fesselte mich das alles so sehr, dass ich immer höher klettern und weiter gehen wollte.
Wie entwickelte sich Ihre Leidenschaft für Aufnahmen unter solch extremen Bedingungen? Warum die Arktis?
Während meiner Zeit an der Universität übernahm ich schließlich die Leitung der Universitätszeitung und war verantwortlich für den Pressedienst. Wie s an Hochschulen üblich ist, fanden auch bei uns zahlreiche Exkursionen und Expeditionen statt, bei denen Dozenten gemeinsam mit Studierenden unterwegs waren. Mein erstes „extremes“ Ziel führte mich auf eine wissenschaftliche Expedition zur Insel Kolguew in der Barentssee, wo wir die Arbeitsbedingungen von Schichtarbeitern untersuchten. Als Fotograf begleitete ich das Team von Wissenschaftlern, die vor Ort ihre Forschungen durchführten. Zwei Wochen lang lebten wir im März in dieser rauen Umgebung – der Winter hatte die Tundra fest im Griff. Mit dem Hubschrauber wurden wir abgesetzt und es war alles sehr romantisch.
Seit diesem Erlebnis hat mich der Norden in den Bann gezogen, und ich versuche seither, so oft wie möglich dorthin zu reisen. Ein weiteres bedeutendes Projekt, an dem ich teilnehmen durfte, war „Roter Tschum“. Dieses alte sowjetische Vorhaben wurde von Erdölarbeitern wiederbelebt und hatte zum Ziel, der nomadischen Bevölkerung in der Tundra Unterstützung zu bieten. Wir waren zu zweit „aus der Zivilisation“: Der erste war ein Arzt und der zweite war ich, der Assistent des Arztes. Meine Rolle als „Kulturarbeiter“ führte uns in eine Rentierzuchttruppe. Ausgestattet mit einem Führer, einem Schlitten voller Rentiere und all unseren Habseligkeiten reisten wir zwischen verschiedenen Rentierzuchttruppen umher. Über einen Zeitraum von mehr als einem Monat durchquerten wir die Tundra, besuchten sieben oder acht Rentierzuchttruppen und lebten unter einfachsten Bedingungen: in Zelten, während wir rohes Fleisch und Beeren aßen und sogar Blut tranken. Wir hüteten Rentiere und fielen vom Schlitten. Es war fantastisch. Es spannte sich über uns ein klarer Himmel, während sich die unendliche Weite des Nordens vor unseren Augen entfaltete. Doch nach einem Monat kehrte ich zurück nach Hause – und als ich aufwachte, blickte ich nun auf eine Decke über mir. Diese Enge erdrückte mich förmlich; das Verlangen, zurückzukehren, wurde groß. Seither habe ich stets versucht, den nördlichsten Norden zu erreichen und an interessanten Projekten teilzunehmen.
Zunächst führte mich das Leben nach Moskau, wo ich für das Gesundheitsministerium tätig war. Ich einem Büro am Roten Platz saß ich vor meinem Computer, als ich die Nachricht erhielt, dass der Nationalpark „Russkaja Arktika“ in Archangelsk eröffnet worden war. Während die Mitarbeiter des Parks zum Nordpol und ins Franz-Josef-Land aufbrachen, blieb ich in meinem Büro. Plötzlich entschied ich mich dazu ein Kündigungsschreiben zu verfassen. Ich stand auf und machte mich auf den Weg zurück nach Archangelsk, um diesen faszinierenden Nationalpark zu besuchen. Denn es ist unmöglich, ohne einen Traum zu leben – besonders wenn man sieht, dass er zum Greifen nah ist. Man muss einfach den Mut aufbringen, aufzustehen und den ersten Schritt zu wagen.
„Ich möchte im Lotto gewinnen“ – also kaufe ein Lotterielos. „Ich will in die Arktis“ – kündige deinen Job und mache dich auf den Weg dorthin. Und so geschah es schließlich auch bei mir.
Welche Emotionen begleiteten Sie, als Sie sich auf Ihre erste Expedition begaben?
Ich konnte einfach nicht fassen, was da wirklich geschah. Bis zum letzten Moment blieb der Zweifel in mir. Als ich schließlich im Nationalpark ankam, sagte ich: „Leute, ich werde euch nützlich sein! Ich kann fotografieren, ich scheue mich nicht vor Reisen und habe keine Angst vor extremen Bedingungen“. Da wurde mir mitgeteilt: „In Ordnung, wir brechen am ersten August zum Franz-Josef-Land auf“. Manchmal beobachte ich die neuen Leute, die zum ersten Mal zu uns kommen. Sie stellen immer wieder die gleichen Fragen: „Werden uns die Eisbären nicht fressen? Haben die Eisberge wirklich diese Farben? Werden wir Reisekrankheit und Übelkeit bekommen?“ Was für ein Gefühl muss es sein, an einen Ort zu gelangen, der so unwirklich erscheint? Was bedeutet das „Franz-Josef-Land“ für den gewöhnlichen Menschen? Es ist wie aus einem Film, einem Buch oder dem Fernsehen – genau so fühlte es sich an. Wenn das Schiff Murmansk verlässt und nach ein oder zwei Tagen diese Inseln mit ihren Eiskappen am Horizont auftauchen, wenn andere Vögel umherfliegen und Eisberge im Wasser treiben, dann ist das wahrhaftig märchenhaft.
Jeder Mensch hat einen Ort auf dieser Erde, der ihn fasziniert. Nicht jeder muss die Arktis lieben oder mögen; doch wenn jemand diesen besonderen Ort findet, der für ihn „das Eine“ ist – das ist das Wichtigste. Jeder sollte einen solchen Ort für sich selbst entdecken. Für manche mag es der Kaukasus sein, für andere der Baikalsee oder die Kurilen. Für mich jedoch ist es die Arktis.
Wie gelingt es Ihnen, sich immer wieder zu überwinden und bei eisiger Kälte, in der Nacht oder im Morgengrauen mit Ihrer Ausrüstung hinauszugehen?
Wenn das Herz vor Freude hüpft, der Wind ins Gesicht bläst und die erfrorenen Finger über die Knöpfe gleiten, dann geschieht alles ganz von selbst – man muss sich nicht zwingen.
Die richtige Ausrüstung spielt dabei eine entscheidende Rolle: In der Arktis verliert die Kälte ihren Schrecken, wenn man gut vorbereitet ist, sich angemessen kleidet und vielleicht sogar einen Bart wachsen lässt. Mit moderner Bekleidung kann man 24 Stunden lang im Freien verweilen, ohne ein unangenehmes Gefühl zu verspüren.
Doch neben der passenden Ausrüstung steht die Sicherheit an oberster Stelle: Es ist ratsam, niemals allein hinauszugehen, besonders nicht in der Dunkelheit. Eine Signalpistole und eine Waffe sollten stets griffbereit sein, ebenso wie das Wissen darüber, wie man Bären vertreibt und sich in verschiedenen Situationen verhält. Vorbereitung ist von größter Bedeutung.
Denn wer sonst könnte diese Bilder festhalten? Es wird einem bewusst, dass im Umkreis von zwei- oder dreitausend Kilometern kein anderer Fotografe anzutreffen ist. Diese Exklusivität zieht einen immer wieder an diesen Ort zurück.
Verliert man mit der Zeit die Angst? Es ist in der Tat beängstigend, allein auf einem abgelegenen Weg zu sein, umgeben von endlosen Weiten, in denen Bären und Schnee herrschen.
Die Angst sollte nicht verschwinden. Wenn wir aufhören, Angst zu empfinden, setzen wir unser Leben aufs Spiel. Jedes Mal gilt es, alle Möglichkeiten abzuwägen. Nehmen wir an, ich mache eine Schneemobilfahrt und mein Fahrzeug bleibt plötzlich stehen – ab wann gibt es kein Zurück mehr? Setze ich meinen Weg fort oder nicht? Gehe ich das Risiko ein oder nicht? Wenn wir mit dem Boot unterwegs sind und der Wind aufkommt, wo werden wir anlegen? Wird die Munition nass, wenn wir ins Wasser fallen oder nicht? Jeder Schritt muss sorgfältig durchdacht werden.
Die Arktis ist ein raues Terrain; jedes Jahr gibt es tragische Unfälle und Bärenangriffe. In solchen Momenten wird mir bewusst: Ich habe zwei kleine Kinder zu Hause.
Was zählt mehr – ein paar Aufnahmen zu machen oder die Gewissheit, nach Hause zurückzukehren? Diese Überlegungen sind entscheidend, wenn es um das Risiko geht. Wie auf den Plakaten steht: „Fahrer, du wirst zu Hause erwartet“. So könnte man auch sagen: „Polarforscher, du wirst zu Hause erwartet“. Natürlich ist das Eingehen von Risiken eine edle Sache, aber meine Frau sagt immer: „Kolja, wenn dich ein Bär frisst, werde ich dich finden und töten“.
Wenn ich Gruppen begleite, bin ich einer der gewissenhaftesten Begleiter. Jeder überprüft alles mehrmals, bevor wir uns auf den Weg machen. Niemand verlässt den sicheren Hafen ohne die nötige Erlaubnis. Es ist eine andere Verantwortung, für sich selbst zu sorgen – man kennt seine Grenzen. Doch als Anführer trägt man die Verantwortung für andere. Manchmal nennen sie mich: „Kolja, der Rückversicherer“. Ja, das bin ich. Sind alle lebend zurückgekehrt? Wir sollten immer dankbar sein, dass man lebend zurückgekommen ist. Manchmal kann es ganz anders aussehen.
Sie werden vor allem als Landschaftsfotograf wahrgenommen, doch Ihre urbanen Reportagen sind ebenso bemerkenswert – subtil und mit einem Hauch von Ironie. Gibt es für diese Fotografien eine besondere Stimmung, oder sind Sie stets bereit, das Außergewöhnliche im Alltäglichen zu entdecken?
Die Grabungssaison ist kurz und der Sommer in der Arktis ist besonders flüchtig – nur zwei Monate bleiben für die eigentliche Arbeit. Ich den Wintermonaten war ich nie dort, was aus der Perspektive eines Fotografen wenig Sinn macht. Dennoch bleibt das Bedürfnis zu fotografieren bestehen, denn es gilt, die eigenen Fähigkeiten kontinuierlich weiterzuentwickeln.
Das Auge eines Fotografen ist darauf geschult, ständig nach Motiven Ausschau zu halten; man nimmt alles um sich herum wahr. Wenn ein interessantes Motiv ins Blickfeld rückt, drängt es förmlich danach, festgehalten zu werden. So übt man neue Kompositionen und verfeinert die Fähigkeit, nach Motiven zu suchen. Lässt man jedoch die Kamera über einen Zeitraum von acht Monaten ungenutzt, wird es eine Herausforderung, wieder in den kreativen Fluss zurückzufinden. Fotografiert man hingegen in der Stadt und fängt dort Motive ein, bleibt die fotografische Sensibilität lebendig.
Letztendlich gilt: Entweder man fotografiert kontinuierlich oder man lässt es ganz sein.
Ist die Fähigkeit, bestimmte Motive zu erkennen, eher das Ergebnis von angeborenem Talent oder das Resultat gezielten Lernens und Aneignens?
Hier vereinen sich alle Aspekte, denn wer Fotograf werden möchte, benötigt zu Beginn einen gewissen Willen. Der Entschluss „Ich will Fotograf werden“ bedeutet, dass man bestimmte Motive und Themen festhalten möchte. Doch mit bloßem Wunsch allein kommt man nicht weit. Kreativität ist ähnlich wie der Sport: Man kann nicht heute 100 Kilo heben und morgen bereits 200 Kilo. Es erfordert Beobachtung, Übung und das Lernen von anderen. Man muss täglich versuchen, seine Fähigkeiten zu verfeinern, bis man eine gewisse Grenze erreicht. Doch ohne den Versuch, diese Grenze ständig zu erweitern, wird man sie nie entdecken. Wenn du sagst: „Das war's, ich bin jetzt ein Super-Meister – jedes Mal, wenn ich hinausgehe, werde ich ein Meisterwerk schaffen“, dann wird das nicht funktionieren. Es ist entscheidend, jeden Tag hinauszugehen und Fotos zu machen – immer wieder und immer wieder, sogar mit dem Handy. Wenn du plötzlich einen interessanten Schatten entdeckst, zögere nicht, ihn festzuhalten.
Ich sage meinen Schülern oft, auch wenn sie auf offiziellen Veranstaltungen sind: „Leute, ihr müsst nicht von Anfang bis Ende fotografieren. Konzentriert euch zunächst auf das Wesentliche und versucht dann, kreativ zu werden“. Die Fähigkeit zur Kreativität wird nicht durch die Arbeit bei einer Zeitung gefördert; dafür braucht es keine Kreativität. Kreativität ist etwas Persönliches – es ist für das eigene Vergnügen.
Was war das Interessanteste Motiv, das Sie innerhalb der Stadtgrenzen fotografieren konnten?
Fotografien offenbaren sich erst mit der Zeit. Was uns in einem Moment als faszinierend erscheint, kann sich in zehn Jahren als „so lala“ herausstellen. Doch es gibt auch jene Fotos, die über ein ganzes Jahrzehnt hinweg ihre Anziehungskraft und Faszination bewahren. Eines dieser bemerkenswerten Fotos, das mir bis heute gefällt, entstand zwischen 2005 und 2006. Es war der Tag der Stadt in Archangelsk, und an diesem Tag wird jedes Mal ein großes Poster des Erzengels Michael, nach dem die Stadt benannt ist, am Rathaus aufgehangen. An diesem Tag war das Wetter trüb und regnerisch, und die Polizisten trugen ihre Regenmäntel. Es gelang mir, einen dieser Polizisten mit dem Erzengel zu fotografieren. Das Ergebnis war ein Polizist mit Engelsflügeln.
Das Foto strahlte Humor und Freundlichkeit aus – niemals beleidigend. Plötzlich fand es seinen Weg auf verschiedene Websites, darunter auch „Pikabu“, und begann ein Eigenleben zu führen. Eine Zeit lang hegte ich den Wunsch, diesen Mann zu finden und ihn zu fragen, wie er über das Bild denkt und wie sein Leben verläuft. Doch ich entschied mich dagegen; wenn er nicht nach mir suchte, bedeutete das wohl, dass er die Sache ebenfalls mit Humor nahm. Das Wichtigste ist schließlich, niemandem zu schaden oder etwas Schlechtes zu tun. Ich bin überzeugt, dass dieses Foto genau dieses Gleichgewicht gefunden hat. Als Reporter interessiert man sich natürlich immer für den „Helden“: Was ist ihm wohl als nächstes widerfahren? Dieses Bild zählt zweifellos zu meinen Lieblingsaufnahmen von der Stadt.
Fast alle Ihre Stadtfotos strahlen eine liebevolle, humorvolle und fröhliche Atmosphäre aus!
Die wichtigste Erkenntnis ist, dass die Fotos nicht böse oder anstößig sind. Ich bin überzeugt, dass jeder Freude daran hat: die Menschen, die sich selbst aus einer anderen Perspektive betrachten, und ich, weil ich auf diese Weise die Geschichte der Stadt in einem positiven Licht festhalten kann.
Es ist einfach, Bilder von Müll zu machen, doch etwas Schönes darin zu entdecken, erfordert viel mehr.
Jetzt haben Sie Ihre eigene Fotoschule in Archangelsk. Was hat Sie dazu inspiriert, diese Schule zu gründen? Und was empfinden Sie als das Interessanteste daran, anderen das Fotografieren beizubringen?
Die Fotoschule ist ein Projekt, das ich nicht für mich behalten konnte. Im Laufe der Zeit habe ich so viel Erfahrung und Wissen angesammelt, eine solche Sichtweise und innere Verfassung, dass es mir unmöglich wurde, die Entwicklung in der Fotografie ohne eine gewisse Unruhe zu betrachten. Ich verspürte den Wunsch, dieses Wissen zu teilen und es zu lehren – damit das Betrachten von Bildern im Feed Freude bereitet.
Inzwischen feiert die Fotoschule ihr 16-jähriges Bestehen. Seit ihrer Gründung im Jahr 2008 haben viele Teilnehmende, die zwischen 2010 und 2012 zu uns kamen, den Sprung in die professionelle Fotografie gewagt und sind mittlerweile sogar besser geworden als ich.
Das ist großartig, denn ein wahrhaft guter Lehrer erkennt seinen Erfolg daran, dass seine Schüler über ihn hinauswachsen.
Deshalb freue ich mich sehr für viele Menschen. Es ist offensichtlich, dass viele Menschen zur Fotoschule kommen, um zu lernen, wie sie für sich und ihre Familien schöne Bilder machen können. Handys und Kameras sind heutzutage sehr beliebt, und viele glauben, dass sie automatisch beeindruckende Fotos liefern. Doch das ist ein Trugschluss. So wie ein Auto nicht von alleine fährt – egal wie modern es ist – funktioniert auch eine Kamera nicht ohne das nötige Know-how. Das ist der Grund, warum Menschen diese Fähigkeit lernen. Wir bieten eine Vielzahl von Kursen an. Wir beginnen mit einem Grundkurs für alle und leiten dann die Schüler je nach ihren Interessen in verschiedene Richtungen: Studiofotografie, Reportage oder Landschaftsfotografie. Nach zwei bis vier Kursen und einigen Treffen organisieren wir Exkursionen oder Veranstaltungen. Man beobachtet über ein Jahr oder länger, wie die Teilnehmenden in ihren Fähigkeiten wachsen.
Letztendlich hängt alles von der Person selbst ab. Es gibt ein Sprichwort: „Fotografie kann man nicht lehren, aber man kann sie lernen“.
In diesem Prozess ist es wichtig, sowohl maximale Freiheit als auch umfassende Unterstützung zu bieten. Oft haben Menschen Angst, über ihre Grenzen hinauszugehen. Daraufhin sagen wir ihnen: „Ja, geh hinaus, spring ins Unbekannte, lauf und schau niemals zurück“. „Ist das wirklich möglich?“ – Ja, das muss so sein. Man soll niemanden fragen. Einfach aufstehen und handeln.
Alles, was man braucht, sind klare Erklärungen zu den Einstellungen: Warum funktioniert etwas nicht? Wie halte ich die Kamera richtig? Wie drücke ich den Auslöser? Wie synchronisiere ich den Blitz? Der persönliche Stil hingegen ist etwas, das jeder für sich selbst entdecken muss. Hier gibt es keine Einschränkungen – gut oder schlecht existieren in der Kunst nicht als feste Kriterien; andernfalls wäre s keine Kunst mehr.
Wir nennen unsere Schule scherzhaft eine „Sekte“, denn die Gemeinschaft spielt eine entscheidende Rolle. Es ist oft schwer, allein zu sein; in einer Gemeinschaft hingegen ist es immer einfacher.
Wie kam es dazu, dass Sie Nikolaj Litau kennengelernt haben? Er ist der Preisträger des gesamtrussischen Wettbewerbs „Russlands herausragende Deutsche“. Es ist interessant zu sehen, dass Sie nicht der Einzige aus der Gemeinschaft der Russlanddeutschen sind, der eine so große Leidenschaft für die Arktis hegt.
Um ehrlich zu sein, war mir nicht einmal bewusst, dass er Deutscher ist. Seit meiner Kindheit trage ich einen ungewöhnlichen Nachnamen und habe eine gelassene Haltung gegenüber allen ausländischen Nachnamen. Ich versuche nicht, die Nationalität eines Menschen zu ergründen, denn ganz ehrlich, es interessiert mich nicht besonders.
Es gibt nur wenige Menschen, die irgendwelche Projekte in der Arktis durchführen, und die Yachten kann man an einer Hand abzählen. Daher kreuzen sich die Wege all dieser Menschen früher oder später, denn die Routen sind dieselben und es gibt nicht so viele Archipele. Litau ist seit langem ein Begriff in diesem Kreis; seine Yacht legte oft in Archangelsk an, aber irgendwie bin ich in Archangelsk daran vorbeigegangen und das war's. Es stellte sich heraus, dass in Narjan-Mar unsere Yacht, auf der ich arbeitete, stand, und Litau stand daneben am Liegeplatz. Am Abend kamen sie an und gingen hinaus, um sich zu treffen und kennenzulernen. Kurz darauf lud er uns auf seine Yacht ein. Zu meiner Überraschung hatte er sogar ein Buch mit meinen Fotos dabei. Ich sagte: „Sieh mal einer an! Ich segle ja tatsächlich schon auf einer Yacht“. Wir haben gelacht.
Es ist wichtig zu betonen, dass es hier keine Konkurrenz gibt. Es ist dreifach erfreulich, sich mit einem solchen Menschen auszutauschen – Litau ist zweifelsohne eine Legende unter den Expeditionsteilnehmenden. Dass er zufällig zur Gemeinschaft der Russlanddeutschen gehört, war für mich lediglich eine angenehme Ergänzung. Unser deutsches Volk findet man überall – selbst in der Arktis.
Würden Sie uns ein wenig über Ihre deutschen Wurzeln berichten?
Im 18. Jahrhundert fanden meine Vorfahren ihren Weg nach Archangelsk, wo sie zahlreiche Projekte ins Leben riefen. Im Herzen der Stadt gab es eine Holzfabrik und eine Seilerei und sie lebten in der Nemezkaja Sloboda (dt.: Deutsche Vorstadt). Leider sind von diesen Orten heute keine Spuren mehr zu finden; Archangelsk wurde vollständig neu gestaltet, und alles, was einst war, ist verschwunden. Ein Teil meiner Familie litt unter den Repressionen jener Zeit, während andere die Stadt verließen, als die Intervention in Archangelsk stattfand.
In den 90er Jahren erlebte Archangelsk ein bedeutendes Ereignis: Eugenie Fraser (geb. Scholz) kehrte zurück. Sie war in Archangelsk geboren worden und war als Kind mit ihren Eltern nach Schottland gezogen, gerade als die Interventionisten abzogen. Ihr ganzes Leben lang lebte sie dort, doch die Erinnerung an ihre russische Kindheit blieben lebendig. Sie führte Tagebuch und machte sich Notizen. Eugenie veröffentlichte das Buch „Das Haus an der Dwina“ (Orig.: The House by the Dvina), das für Archangelsk ein kulturelles Highlight darstellte. Dank dieses Werkes erwachte die soziale Bewegung der Nemezkaja Sloboda zum neuen Leben; sogar die soziale Bewegung „Nemezkaja Sloboda in Archangelsk“ wurde gegründet. Menschen begannen sich zu versammeln und führten Aufführungen auf, die von der Geschichte ihres Buches inspiriert waren.
Es stellte sich heraus, dass Eugenie Fraser die Cousine meiner Großmutter väterlicherseits war. Später veröffentlichte sie ein weiteres Buch mit dem Titel „Nur die Dwina“ (Orig.: The Dvina Remains). Von der Stadt, in der sie geboren wurde, blieb nur noch der Fluss, an den sie sich erinnerte. Eines Tages kam ihr Sohn Michael zu Besuch. An der Stelle, an der einst ihr Haus stand, pflanzten sie einen Baum, der heute auf dem Gelände eines Krankenhauses steht und als Gedenkstätte besonders bewacht wird. Leider ist auch Michael bereits verstorben. In diesem Sommer kam nun ihre Enkelin Joanna, meine Cousine vierten Grades, zu Besuch.
Die Auflage des Buches „Das Haus an der Dwina“ war klein; ich selbst besitze ein Exemplar, das sie meinem Vater mit einer persönlichen Inschrift schenkte. Joanna hat den Wunsch, das Buch mit der Übersetzung ihrer Großmutter neu aufzulegen und beide Werke unter einem gemeinsamen Einband zu vereinen.
Ich betrachte mich ganz klar als Russe. Ja, mein Nachname ist geblieben und ich bin sehr stolz darauf sowie auf die Geschichte meiner Familie. Dennoch fühle ich mich in erster Linie als Russe.
Meine andere Hälfte stammt aus der Region Archangelsk, aus dem Hinterland – von einfachen Menschen ohne Titel und Prunk. Auch auf diese Herkunft bin ich nicht weniger stolz als auf die Gernet-Seite meiner Familie. Archangelsk ist für mich eine Heimat im wahrsten Sinne des Wortes. Deshalb ist für mich der Norden, Archangelsk, natürlich meine Seelenheimat. Ich mag den Norden, ich fühle mich hier wohl und geborgen. Es liegt mir am Herzen, dass Archangelsk sich weiterentwickelt und wächst – ich wünsche mir für dieses Stadt nur das Beste.
Ich bin sehr stolz auf meine deutschen Vorfahren und ich bemühe mich, mit ihnen zusammenzuarbeiten. In Archangelsk gibt es eine russlanddeutsche Gemeinschaft, die sich an mich gewandt hat, um einige Artikel und Materialien meines Vaters zu erhalten, der in den Archiven tätig war. Gerne habe ich diese Dokumente mit ihnen geteilt. Sie wurden veröffentlicht, und mein Vater hatte sogar die Gelegenheit, mit jemandem zu korrespondieren.
Nikolaj, was würden Sie sich als Kind sagen?
Hab vor nichts Angst.
Und was würden Sie sich in fünf Jahren fragen?
Diese Frage ist schwieriger. Wahrscheinlich: „Bereust du etwas? Bist du dir selbst treu geblieben?“ So.
Übersetzt aus dem Russischen von Evelyn Ruge