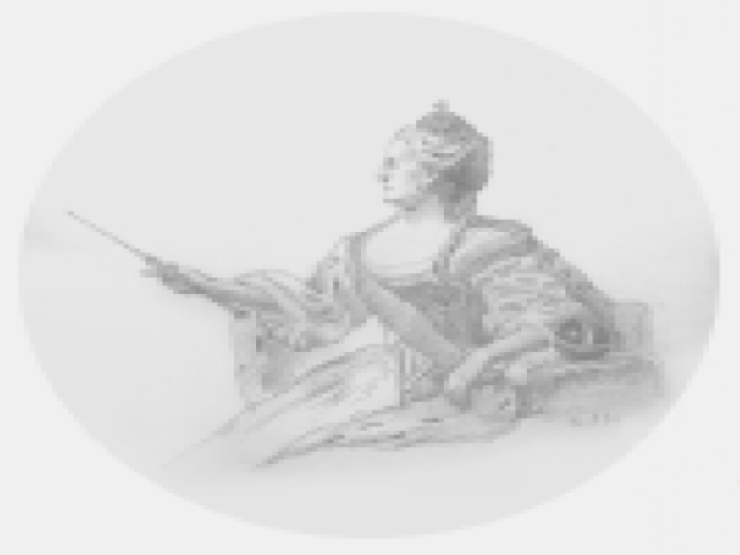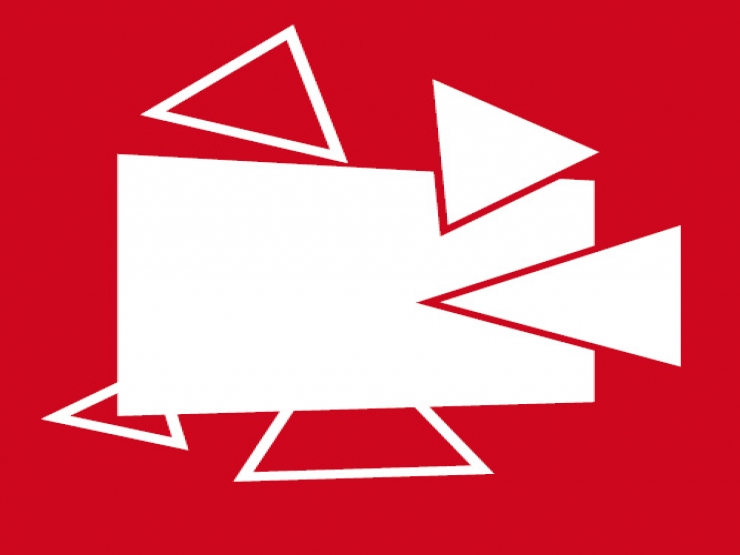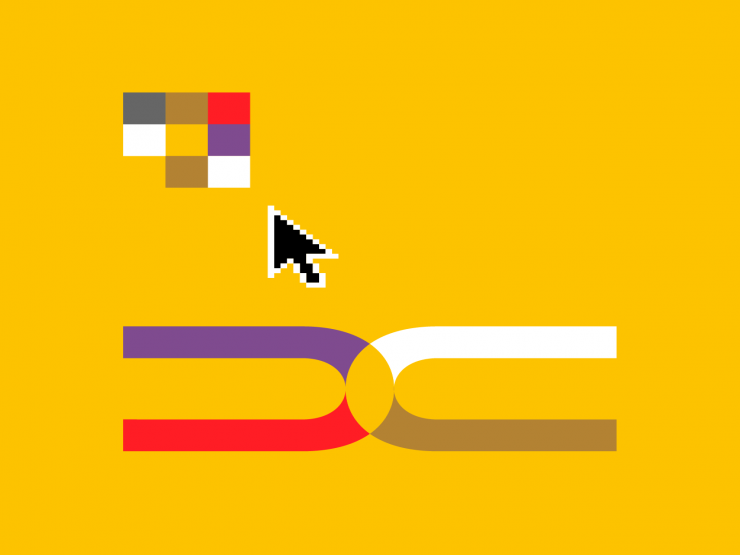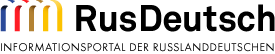Das Schicksal der Leningrader Deutschen im Zweiten Weltkrieg galt unter russischen Historikern lange als Tabu. Zum 70-jährigen Jahrestag der Massenmobilisierung der Russlanddeutschen in die Arbeitsarmee widmet sich jetzt die Historikerin, Dr. Irina Tscherkasjanowa, dem Thema der Repression und Massendeportation mit vielen Details und einer langen Opferliste. Ihre wissenschaftliche Studie „Die Leningrader Deutschen - Das Schicksal der Kriegsgenerationen", die zum 70-jährigen Jubiläum der Massendeportation veröffentlicht wurde, stellt eine Art Heilmittel gegen die allgemeine Gedächtnisschwäche dar und soll dem Leser zum Abbau von Mythen und Vorurteilen sowie zu einem unparteiischen Umgang mit der Geschichte bewegen.
 Das Schicksal der Leningrader Deutschen im Zweiten Weltkrieg galt unter russischen Historikern lange als Tabu. Zum 70-jährigen Jubiläum widmet sich jetzt die Historikerin, Dr. Irina Tscherkasjanowa, dem Thema der Repression und Massendeportation mit vielen Details und einer langen Opferliste.
Das Schicksal der Leningrader Deutschen im Zweiten Weltkrieg galt unter russischen Historikern lange als Tabu. Zum 70-jährigen Jubiläum widmet sich jetzt die Historikerin, Dr. Irina Tscherkasjanowa, dem Thema der Repression und Massendeportation mit vielen Details und einer langen Opferliste.
In Dostojevskijs Petersburg wimmelt es nur so von Deutschen - da ist der deutsche Hutmacher Raskolnikows, das Frauenzimmer Rößlich, frivole Straßenmädchen, die auf dem Polizeirevier Duftwolken verströmen, eine rotnasige Münchnern in der Kneipe, unter der alten Pfandleiherin wohnen Deutsche, und die armen Marmeladows werden von ihrer Vermieterin, Frau Lippewechsel, mit Geldforderungen traktiert.
Deutsche Siedler kamen erstmals auf Einladung Peter des Großen und Katharina der Zweiten nach Sankt Petersburg. Ende des 19. Jahrhunderts bildeten sie bereits die größte nationale Minderheit des Petersburger Archipels. Ihr soziales Spektrum war breit - Akademiker und Handwerker, Künstler und einfache Leute. Gemeinsam trugen sie wesentlich zum wirtschaftlichen Florieren der Hauptstadt und der umliegenden Kolonien bei.
Heute dagegen ist die deutsche Prägung Petersburgs, abgesehen von ein paar Lichtgestalten, zum größten Teil in Vergessenheit geraten. Ihre Belle Epoque endete mit dem ersten Weltkrieg, danach wurde es für die Deutschen in Sankt Petersburg unbequem. 1941-1942 kam es schließlich zur Massendeportation: während der Leningrader Blockade wurden die deutschen Einwohner innerhalb des Blockaderings nach Osten deportiert, die Bewohner des besetzten Umlandes in den Westen verschleppt. „Eine der Folgen der Deportation war das Verschwinden nicht nur der deutschen Siedlungen um Leningrad, sondern auch der Erinnerung an sie”, schließt Irina Tscherkasjanova in „Die Leningrader Deutschen - Das Schicksal der Kriegsgenerationen". Ihre Studie, veröffentlicht zum 70-jährigen Jubiläum der Massendeportation, stellt eine Art Heilmittel gegen die allgemeine Gedächtnisschwäche dar. Neben einem konzisen geschichtlichen Überblick und Zeitdokumenten enthält das Buch eine dreihundertseitige Liste der Unterdrückungsopfer.
Entfernung „sozial gefährlicher Elemente“
Am 8. September 1941, nach der Einnahme von Schlüsselburg durch die Wehrmacht, hat sich der Blockadering um Leningrad geschlossen. Zu dieser Zeit lebten in der Leningrader Oblast, die damals auch die heutigen Novgoroder und Psovsker Oblasts umfasste, etwa 30.000 Deutsche. Die deutschen Kolonien lagen zum Teil innerhalb der Blockade, zum Teil auf dem besetzten Gebiet. In ihrer Verlegenheit beschlossen die sowjetischen Kader, die so genannten „sozial gefährlichen Elemente” aus dem blockierten Gebiet zu entfernen. Am 26. August 1941 erließ der Kriegsrat der Leningrader Front die geheime Verordnung N° 196 „Über eine obligatorische Evakuierung der deutschen und finnischen Bevölkerung aus den Vorstadtregionen Leningrads”. Innerhalb weniger Tage war die erste Großaktion der „Evakuierung” der Deutschen in den Osten abgeschlossen.
Den wenigen übriggebliebenen Deutschen erging es nicht viel besser, denn im Winter 1941-1942 starb vor Hunger jeder dritte Bewohner der Leningrader Blockade. Im März 1942 wurde der Deportationsbefehl erneuert — in der letzten Märzwoche wurde die überwältigende Mehrheit der Deutschen, die noch über den Winter in Petersburg hatten bleiben „dürfen“, deportiert. Mit dieser Eklipse endete bis auf Weiteres die Geschichte der Petersburger Deutschen. Die Gesamtzahl der Deportierten ist umstritten, Tatsache ist, dass die offizielle Zahl von 11.000 weit unter der wirklichen Ziffer liegt. Im Wesentlichen wurden sie in die Krasnoyarsker, Omsker oder Irkusker Region verschleppt, wo sie in eine so genannte Arbeitsarmee einberufen wurden, und dort bei Schwerstarbeiten, zum Beispiel in der Forstwirtschaft, in Bergwerken oder in der Fischindustrie eingesetzt. Die Bedingungen in den Siedlungen waren teilweise katastrophal: eine geologische Expedition berichtete von einer Masse an Leichen in Ust-Khantaika im hohen Norden, wo eine deutsche Kolonie ohne Öfen, Werkzeuge oder Verpflegung nur mit Zelten zurückgelassen worden war.
Aus den besetzten Gebieten wiederum wurde die Mehrheit der russischen Deutschen nach Westen „repatriiert”. Die großflächige Aussiedlung wurde vom Kommandant der deutschen Armee am 25. Januar 1942 angeordnet, da zu diesem Zeitpunkt ein sowjetischer Durchbruch der Blockade nicht unwahrscheinlich erschien. Man fühlte sich also berufen, die Menschen vor ihren eigenen Landsleuten zu retten. Die meisten Deutschen wurden nach Estland, Lettland, Litauen, Polen und Deutschland verschleppt, die männliche Bevölkerung wurde in die Wehrmacht eingezogen.
„Uns war irgendwie alles egal”
Fair an Tscherkasjanowas Darstellung ist, dass sie zwar manchmal etwas pietätsvoll von „tragischen” Schicksalen spricht, aber auch die Ansichten nicht verschweigt, die diese Pietät begründen. So bleibt nicht unerwähnt, dass für viele Menschen der Überlebenskampf und nicht der Heimatverlust die Hauptsorge darstellte. „Uns war irgendwie alles egal”, kommentiert J. P. Krylov aus Strelna die Evakuaierung nach Deutschland. Besonders die Bewohner innerhalb des Blockaderings waren häufig gleichgültig gegenüber ihrer Deportation. Wie Tscherkasjanova an einer anderen Stelle erwähnt, soll es sogar Russen gegeben haben, die sich beschwerten, nicht auch nach Sibirien ausreisen zu dürfen.
Rückkehrverbot bis 1972
Besonders liegt es Tscherkasjanowa daran, das Rückkehrverbot zu betonen, das die Leningrader Deutschen, wie auch die anderen Russlanddeutschen, noch lange nach Kriegsende verfolgte. Die in den Westen verschleppten Deutschen aus der besetzten Zone wurden zwar, wie auf der Jalta-Konferenz vereinbart, in den Jahren 1945-1948 wieder an die Sowjetunion ausgeliefert. Dies hieß aber nicht, dass sie an ihre Heimatorte zurückkehren konnten. Die meisten von ihnen kamen in sibirische Lager und mussten später, bis 1955, in Sondersiedlungen mit täglicher Meldepflicht leben. So erging es etwa Pjotr Adamowitsch Eidemiller, der alle Angebote, in Deutschland zu bleiben, Boden und Unterkunft ausschlug, um in seine Heimat zurückzukehren, und dann mit seiner Familie in Jurga in Zentralsibirien zwangssiedeln musste, wo er im Jahr 1981 auch starb. Nicht anders erging es nach Kriegsende den Blockadedeutschen, die im Osten gelandet waren. Im April 1946 wurde zwar die Arbeitsarmee (russisch: Trudarmija) aufgelöst, die ehemaligen Trudarmisten mussten jedoch danach ebenfalls in Sondersiedlungen leben. Ein eigenmächtiges Verlassen des vorgesehenen Wohnorts wurde mit zwanzig Jahren Strafarbeitslager geahndet. Die Sondersiedlungen für die Deutschen wurden zwar 1955 vom Obersten Sowjet aufgehoben, doch auch das bedeutete noch lange keine Erlaubnis zur Rückkehr in die Heimat. Der Leiter des Leningrader Oblispolkom N.V.Soloviev bat bereits 1944 eigenhändig darum, die Rückkehr der Deutschen und Finnen möglichst zu verhindern und „diese Bevölkerung zum Wohnen in den entlegenen Gebieten der Sowjetunion auf die Dauer zu veranlassen”, da das Leningrader Gebiet „von russischer Bevölkerung besiedelt sein” sollte. Der jahrzehntelange Limbo der Deutschen endete erst 1972, als die Einschränkung ihrer Wohnortswahl endgültig aufgehoben wurde.
Das Paradigma der Schicksale
In Tscherkasjanowas Liste der Opfer von Repression, Deportation und Repatriierung sind 3950 Personen erfasst. Die Liste dokumentiert damit das Schicksal der Deutschen aus den heutigen Leningrader, Novgoroder und Pskovsker Oblasts. Jeder Eintrag enthält Name, Geburtsort und ethnische Herkunft der Person, sowie, falls bekannt, Angaben über Bildung und Beruf sowie Vorkriegsadresse. Darauf folgen Auskünfte über das Kriegsschicksal und die Etappen der Verfolgung. Falls erfolgt, enthält die Liste ebenfalls das Datum der Rehabilitierung. Etwas überraschend ist, dass die Liste nicht nur die Opfer der Verfolgung von 1941-1955 erfasst, sondern auch eine beträchtliche Anzahl von Deutschen, die bereits in den 1930er Jahren des Verrats und der Spionage angeklagt und dafür hingerichtet wurden. Überraschend ist ebenfalls, dass die Liste vereinzelt auch Personen enthält, deren Ethnie offiziell als „Russisch” angegeben ist.
Selbst bei einem selektivem Lesen dieser Liste entgeht einem ihre prägnante Wirkung nicht. Man versteht dann besser, warum Tscherkasjanova diesem Teil der Publikation ein so monolithisches Gewicht einräumt. Die Länge der Einträge ist dabei unterschiedlich — während manchmal selbst das Schicksal nach der Deportation unerwähnt bleibt, enthalten andere Einträge minuziöse Informationen über Arbeitsverhältnisse und Wohnorte. Dies spiegelt die Heterogenität des Quellenmaterials wieder. Ein Beispiel für die fast literarische Qualität, die der knappe Stil der Liste manchmal annimmt, ist die Miniatur über Aleksandr Aleksandrowitsch Aman aus Strelna, einen der wenigen glücklich Davongekommenen: „1942 zur Zwangsarbeit nach Wartegau verschleppt. Floh aus dem Lager nach Frankreich, setzte nach England über, befreite mit der englischen Armee Holland. Floh vor der Repatriierung, heiratete eine Holländerin, arbeitete als Fräser im Schiffbau. 3 Kinder, lebte in Holland. Gestorben im Jahr 2002.”
„Das ist kein Leben, wenn man nicht selbst über sich verfügen kann”
Fesselnd an Tscherkasjanownas Darstellung ist insgesamt weniger die Datenmasse, mit der sie den Laien manchmal eher erschöpft, sondern es sind vielmehr die Momente, in denen auf einmal fast teleskopisch persönliche Schicksale zum Ausdruck kommen. Zum Beispiel das von Irina Konstantinovna Ryschkova, die als Kind die Blockade überlebte und das Erlebnis des Hungers mit dem Blick auf den Zeiger der Wanduhr beschreibt, der auf eine wunderbare Weise die Essenszeit näherbringen konnte. Ihr Vater und ihre Mutter starben, sie selbst wurde im August 1942 deportiert. Oder das Schicksal von Pjotr Christianowitsch Vogelgesang, der im Frühling 1942 wegen „antisowjetischer Agitation” verhaftet und zur Erschießung verurteilt wurde, weil er die Lage in der Blockade kritisiert hatte. „Das ist kein Leben, wenn man nicht selbst über sich verfügen kann”, hatte er gesagt. Erst im Jahr 1990, nach 48 Jahren, wurde er rehabilitiert. Ein weiterer ungewöhnlicher Einzelgänger, der bei Tscherkasjanova Beachtung findet, ist Boris Borisowitsch Spasski, mütterlicherseits Deutscher und aufgewachsen in Strelna. 1943 wurde er in die deutsche Armee einberufen und an die italienisch-jugoslawische Front geschickt. An der Front beging er jedoch Fahnenflucht und schloss sich stattdessen den jugoslawischen Partisanen an. Im Herbst 1945 kehrte er nach Leningrad zurück und trat dort in die Hohe Infanterieschule ein. Damit endete aber sein „dramatisches” Schicksal noch nicht: Aufgrund der Verschlechterung der sowjetisch-jugoslawischen Beziehungen wurde er 1948 von der Schule ausgeschlossen und direkt an die Truppen übersandt. Weiter bekannt ist nur, dass er im Jahr 1950 im Hafen Vanino an der fernen Pazifikküste starb, der offiziellen Version nach an einem „Abszess des Bauchfells”.
Sysiphosarbeit und andere Mythen
Tscherkasjanowa schöpft ihre Fakten aus vielfältigen Quellen, von sowjetischen Karteien und Chroniken über private Erinnerungen bis zu elektronischen Datenbanken. Und es ist nicht verwunderlich, dass sie dabei auf zahlreiche Widersprüche und Fehler stößt. Die Plagen reichen von Transliterationsfehlern bei den deutschen Namen (Johann wird zu Ivan, Dorothea zu Darja) über falsche Ortsangaben, Eintragungen von gemischten Familien und Waisenkindern als Russen, Verwechslung der Nationalitäten von Deutschen, Balten und Polen bis zur völligen Willkür. In vielen Fällen sind die Schicksale nur fragmentarisch dokumentiert. Als was sich die Menschen wirklich gefühlt haben, fällt dabei unter den Tisch. Tscherkasjanova behilft sich indirekter Hinweise: „Als Deutsch kann man mit fast hundertprozentiger Sicherheit jemanden erachten, der in einer deutschen Kolonie geboren ist und gelebt hat, deportiert und dann in der Arbeitsarmee eingesetzt oder in eine Sondersiedlung geschickt wurde.”
Zur Ungenauigkeit der Quellen kommt die gezielte Mythenstiftung, die die Arbeit des Historikers weiter deutlich erschwert. Noch lange nach dem Krieg wurden die Deutschen Leningrads als Hitlers „fünfte Kolonie” verdächtigt, ihr Schicksal galt selbst in der Wissenschaft als Tabu. Erst mit der Perestroika begann allmählich die Aufarbeitung. Wie Tscherkazjanova betont, ist das Thema der Deportation noch heute mit sehr vielen Vorurteilen behaftet: „Es gibt nur wenige Beispiele einer geradlinigen Haltung zum Schicksal der Leningrader Deutschen während des Krieges”, schreibt sie. Die heutige Mythenstiftung sei dabei tückischer als zu Sowjetzeiten, weil sie sich als unabsichtlich ausgebe, während sie die totalitären Überreste im kollektiven Bewusstsein nähre. Tscherkasjanowa betont die Wichtigkeit des Abbaus dieser Mythen: „Davon, wie unparteiisch wir uns mit unserer eigenen Geschichte umgehen, hängt die heutige Qualität unseres gegenseitigen Verständnisses und des gegenseitigen Respekts für die Probleme unserer Nachbarn ab, von denen so oder so jeder ein Teil des Volkes Russlands ist.”
Siebzig Jahre später
Heute leben wieder ca. 4000 Deutsche in Sankt Petersburg, sie haben sich wieder von der bête noire in einen Teil des Lebens der Stadt verwandelt. Eine wichtige Rolle bei der Verbesserung der deutsch-russischen Beziehungen spielt dabei das Deutsch-Russische Begegnungszentrum, das auch maßgeblich zur Entstehung von Tscherkasjanowas Arbeit beigetragen hat, vor allem indem es die Kontakte zu den Betroffenenfamilien herstellte. Gegründet 1993, hat sich dieses Zentrum sowohl der Erhaltung des russlanddeutschen Erbes, als auch der aktuellen deutschen Kultur verschrieben. Zum 70-jährigen Jubliäum der Massendeportationen rief es im März einen „Runden Tisch” ins Leben, auf dem Staatsbibliothekare und Historiker im Museum für politische Geschichte über die Verfolgung der Leningrader Deutschen und ihre Dokumentation debattierten.
In Verbindung mit Tscherkasjanowas Publikation erstellte das Begegnungszentrum außerdem eine kleine Ausstellung zu diesem Thema. Neben einer Flügelwand mit Informationen und Fotos zur Deportation enthält sie eine Collage von Originaldokumenten aus der Blockadezeit, von Familien- und Klassenfotos über Totenscheine von Dystrophieopfern und Erschossenen bis zu Rehabilitierungsurkungen. Sie sind ein Teil der Dauerausstellung „Deutsches Leben in Sankt Petersburg” in der Petrikirche, der evangelischen Kirche Petersburgs, die als ehemaliges Schwimmbad selbst ein Emblem der sowjetischen Geschichte ist. An der Dokumentation des Schicksals der Leningrader Deutschen wird also aktiv gearbeitet. Was diese Arbeit aber vor allem zeigt ist, wie viel Arbeit noch bleibt. Tscherkasjanowa schreibt selbst: „Die veröffentlichte Liste von unterdrückten Deutschen hat provisorischen Charakter. Sie ist weit davon entfernt, die reale Zahl der Menschen wiederzuspiegeln, die verschiedensten Arten von Repression ausgesetzt waren.” Auf ihrer Liste fehlen noch einige tausend Namen.
Luisa Marie Schulz